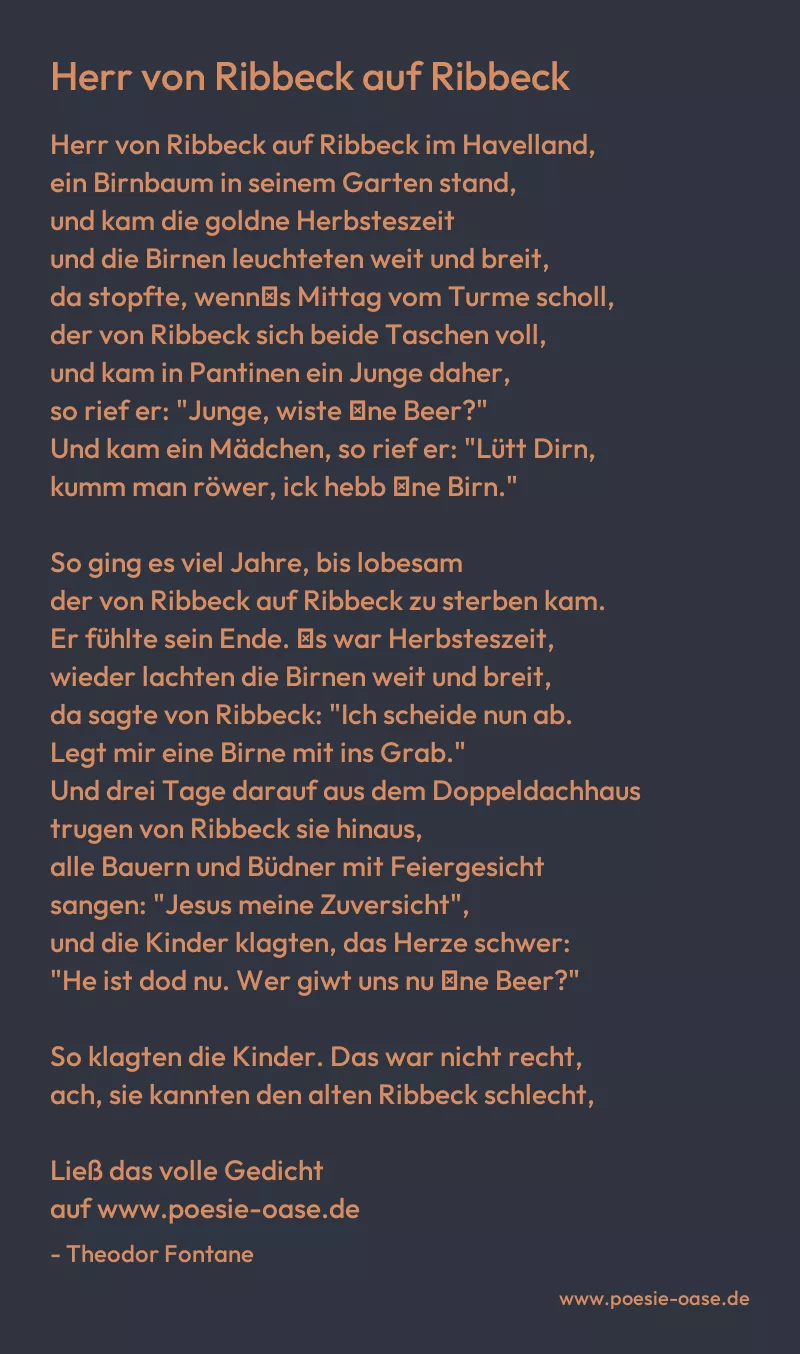Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland,
ein Birnbaum in seinem Garten stand,
und kam die goldne Herbsteszeit
und die Birnen leuchteten weit und breit,
da stopfte, wenn′s Mittag vom Turme scholl,
der von Ribbeck sich beide Taschen voll,
und kam in Pantinen ein Junge daher,
so rief er: „Junge, wiste ′ne Beer?“
Und kam ein Mädchen, so rief er: „Lütt Dirn,
kumm man röwer, ick hebb ′ne Birn.“
So ging es viel Jahre, bis lobesam
der von Ribbeck auf Ribbeck zu sterben kam.
Er fühlte sein Ende. ′s war Herbsteszeit,
wieder lachten die Birnen weit und breit,
da sagte von Ribbeck: „Ich scheide nun ab.
Legt mir eine Birne mit ins Grab.“
Und drei Tage darauf aus dem Doppeldachhaus
trugen von Ribbeck sie hinaus,
alle Bauern und Büdner mit Feiergesicht
sangen: „Jesus meine Zuversicht“,
und die Kinder klagten, das Herze schwer:
„He ist dod nu. Wer giwt uns nu ′ne Beer?“
So klagten die Kinder. Das war nicht recht,
ach, sie kannten den alten Ribbeck schlecht,
der neue freilich, der knausert und spart,
hält Park und Birnbaum strenge verwahrt.
Aber der alte, vorahnend schon
und voll Mißtrauen gegen den eigenen Sohn,
der wußte genau, was er damals tat,
als um eine Birn′ ins Grab er bat,
und im dritten Jahr aus dem stillen Haus
ein Birnbaumsprößling sproßt heraus.
Und die Jahre gehen wohl auf und ab,
längst wölbt sich ein Birnbaum über dem Grab,
uind in der goldnen Herbsteszeit
leuchtet′s wieder weit und breit.
Und kommt ein Jung′ übern Kirchhof her,
da flüstert′s im Baume: „Wiste ′ne Beer?“
Und kommt ein Mädel, so flüstert′s: „Lütt Dirn,
kumm man röwer, ick gew di ′ne Birn.“
So spendet Segen noch immer die Hand
des von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland.