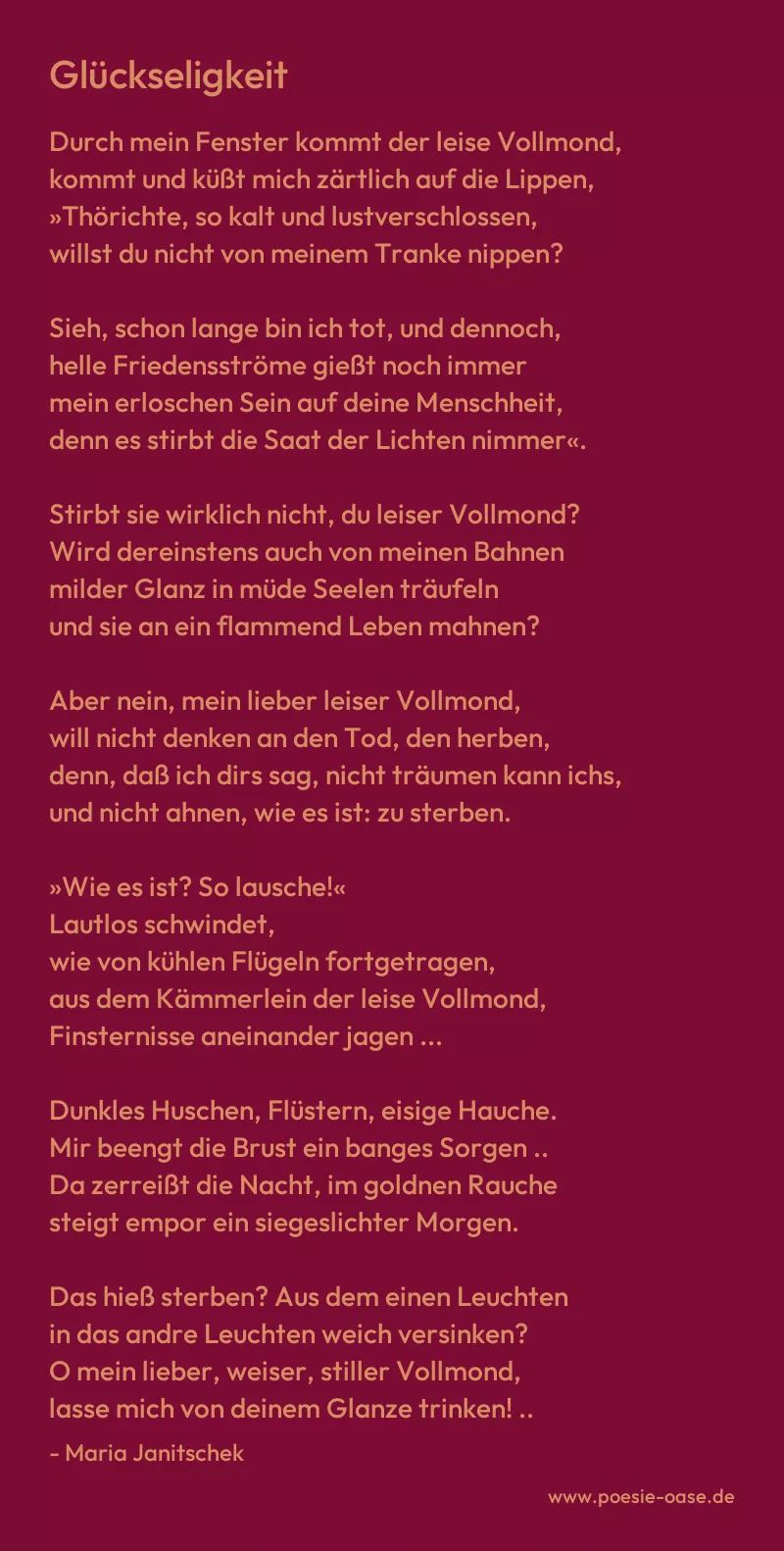Glückseligkeit
Durch mein Fenster kommt der leise Vollmond,
kommt und küßt mich zärtlich auf die Lippen,
»Thörichte, so kalt und lustverschlossen,
willst du nicht von meinem Tranke nippen?
Sieh, schon lange bin ich tot, und dennoch,
helle Friedensströme gießt noch immer
mein erloschen Sein auf deine Menschheit,
denn es stirbt die Saat der Lichten nimmer«.
Stirbt sie wirklich nicht, du leiser Vollmond?
Wird dereinstens auch von meinen Bahnen
milder Glanz in müde Seelen träufeln
und sie an ein flammend Leben mahnen?
Aber nein, mein lieber leiser Vollmond,
will nicht denken an den Tod, den herben,
denn, daß ich dirs sag, nicht träumen kann ichs,
und nicht ahnen, wie es ist: zu sterben.
»Wie es ist? So lausche!«
Lautlos schwindet,
wie von kühlen Flügeln fortgetragen,
aus dem Kämmerlein der leise Vollmond,
Finsternisse aneinander jagen …
Dunkles Huschen, Flüstern, eisige Hauche.
Mir beengt die Brust ein banges Sorgen ..
Da zerreißt die Nacht, im goldnen Rauche
steigt empor ein siegeslichter Morgen.
Das hieß sterben? Aus dem einen Leuchten
in das andre Leuchten weich versinken?
O mein lieber, weiser, stiller Vollmond,
lasse mich von deinem Glanze trinken! ..
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
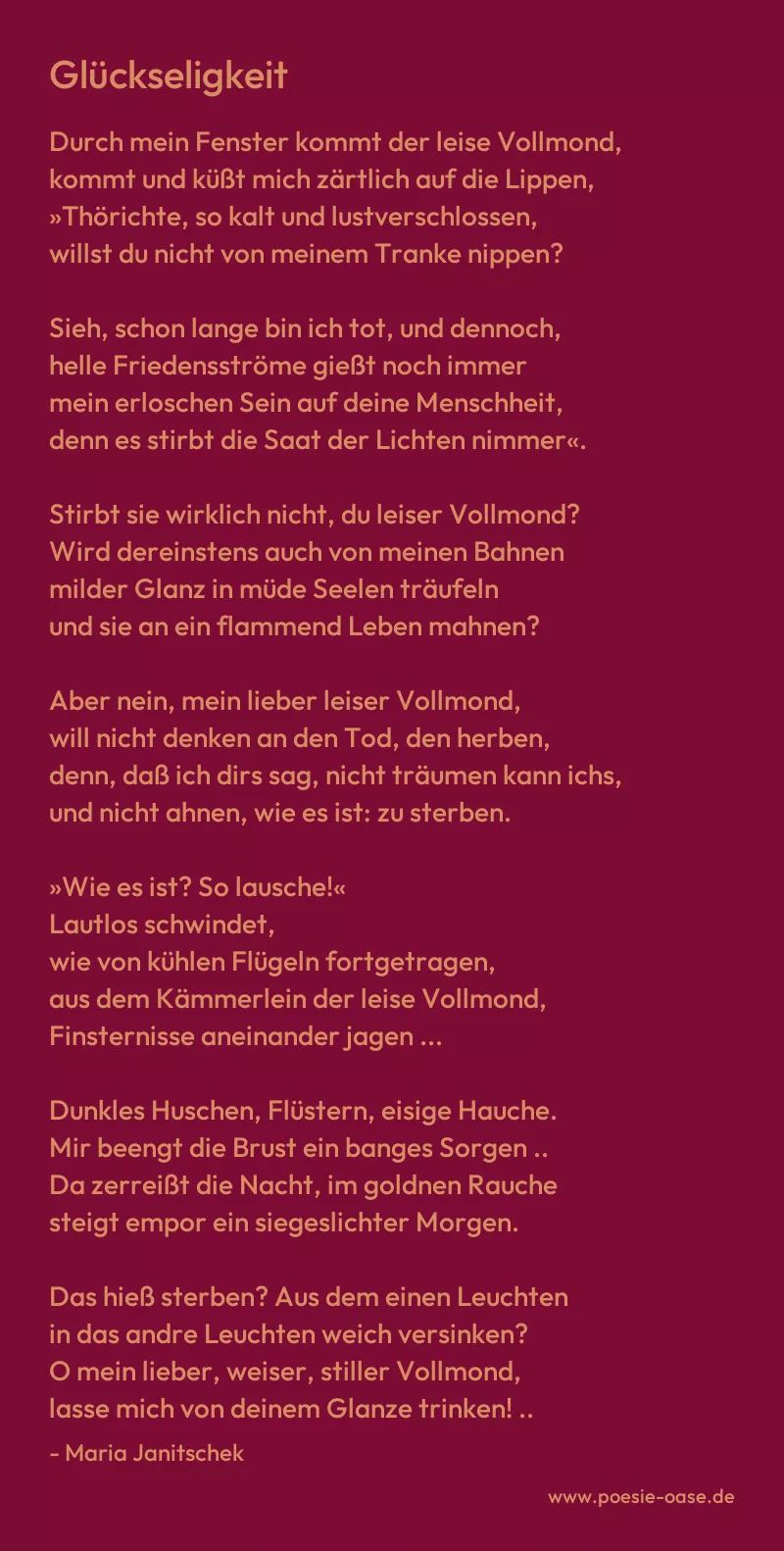
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Glückseligkeit“ von Maria Janitschek ist eine lyrische Auseinandersetzung mit der Thematik des Todes und der Unsterblichkeit, eingebettet in eine romantische Naturmetaphorik. Das Gedicht beginnt mit dem Bild des Mondes, der als sanfter Liebhaber erscheint, der die lyrische Ich-Figur auf die Lippen küsst und sie dazu auffordert, von seinem „Trank“ zu kosten. Dieser Trank steht symbolisch für das Wissen um den Tod und die Unsterblichkeit, die der Mond, als bereits „toter“ Himmelskörper, der Menschheit offenbaren möchte. Der Mond verspricht, dass selbst sein „erloschenes Sein“ noch immer „helle Friedensströme“ ausgießt, was die unsterbliche Natur der „Saat der Lichten“ suggeriert, also das Fortbestehen des Lebens über den Tod hinaus.
Im zweiten Teil des Gedichts wird die lyrische Ich-Figur selbst aktiv und hinterfragt die Aussage des Mondes. Sie drückt den Wunsch aus, dass ihr eigener Glanz, ihr Leben, einmal in die Seelen anderer Menschen „milder Glanz“ träufeln und sie „an ein flammend Leben mahnen“ möge. Allerdings überwiegt die Furcht vor dem Tod, und die Ich-Figur weigert sich, sich mit dem Gedanken an das Sterben auseinanderzusetzen. Sie artikuliert eine tiefe Unkenntnis und Unfähigkeit, sich das Sterben vorzustellen, was ihre lebendige Angst und ihr Festhalten am irdischen Leben verdeutlicht.
Die darauffolgenden Strophen inszenieren eine dramatische Verwandlung, eine Art „Todeserfahrung“. Der Mond verschwindet, und Dunkelheit, Flüstern, eisige Hauche und bange Sorgen ergreifen die Ich-Figur. Diese Beschreibung evoziert ein Gefühl der Beklemmung und des Unbehagens, das den Übergang zum Sterben markiert. Dann jedoch, in einem Moment der Katharsis, „zerreißt die Nacht“, und ein „siegeslichter Morgen“ steigt empor. Dieses Bild des Morgens steht für die Auferstehung, die Befreiung und das Erwachen zu einem neuen Bewusstsein – der Tod wird als Übergang in eine andere Form des Seins dargestellt.
Im letzten Teil des Gedichts wird die Erfahrung des Sterbens als „Aus dem einen Leuchten in das andre Leuchten weich versinken“ interpretiert. Die anfängliche Furcht weicht der Erkenntnis und dem Wunsch nach der Transformation. Die Ich-Figur, nun erleuchtet durch die Erfahrung, bittet den Mond, sie von seinem „Glanze“ trinken zu lassen, was die Bereitschaft symbolisiert, das Wissen um den Tod anzunehmen und sich der Unsterblichkeit hinzugeben. Das Gedicht ist somit ein Plädoyer für die Akzeptanz des Todes als Teil des ewigen Kreislaufs des Lebens. Es ist ein romantischer Ausdruck der Hoffnung, dass das Leben nach dem Tod in irgendeiner Form weiterbesteht, und eine Metapher für die Suche nach Sinn und Glückseligkeit in der Unendlichkeit.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.