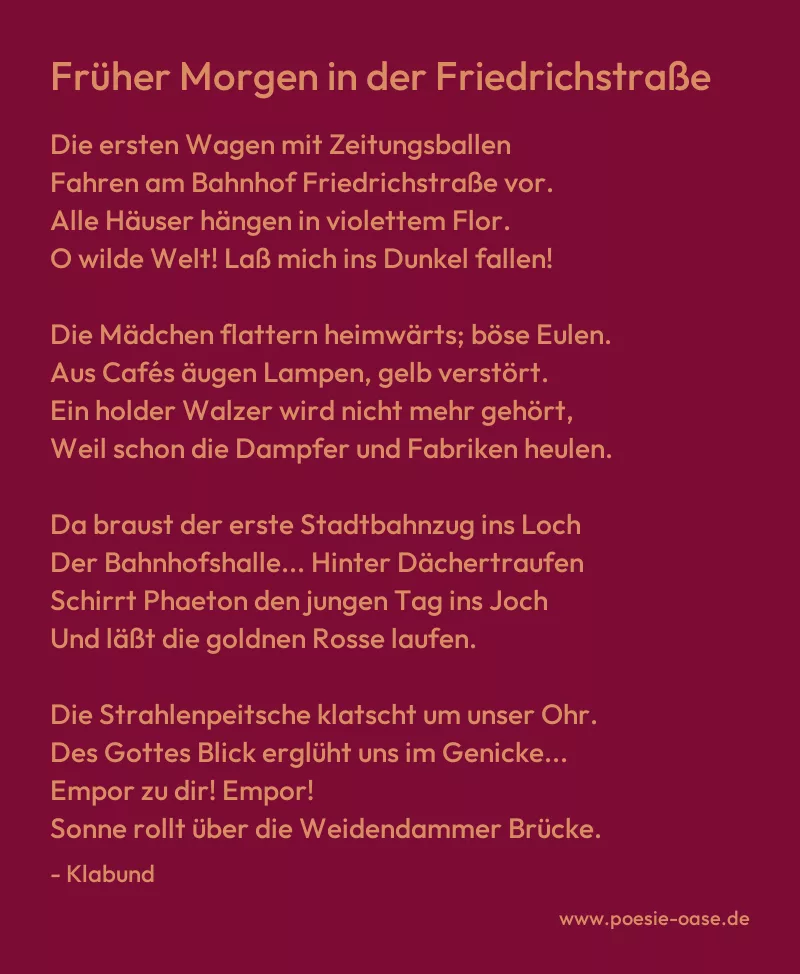Früher Morgen in der Friedrichstraße
Die ersten Wagen mit Zeitungsballen
Fahren am Bahnhof Friedrichstraße vor.
Alle Häuser hängen in violettem Flor.
O wilde Welt! Laß mich ins Dunkel fallen!
Die Mädchen flattern heimwärts; böse Eulen.
Aus Cafés äugen Lampen, gelb verstört.
Ein holder Walzer wird nicht mehr gehört,
Weil schon die Dampfer und Fabriken heulen.
Da braust der erste Stadtbahnzug ins Loch
Der Bahnhofshalle… Hinter Dächertraufen
Schirrt Phaeton den jungen Tag ins Joch
Und läßt die goldnen Rosse laufen.
Die Strahlenpeitsche klatscht um unser Ohr.
Des Gottes Blick erglüht uns im Genicke…
Empor zu dir! Empor!
Sonne rollt über die Weidendammer Brücke.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
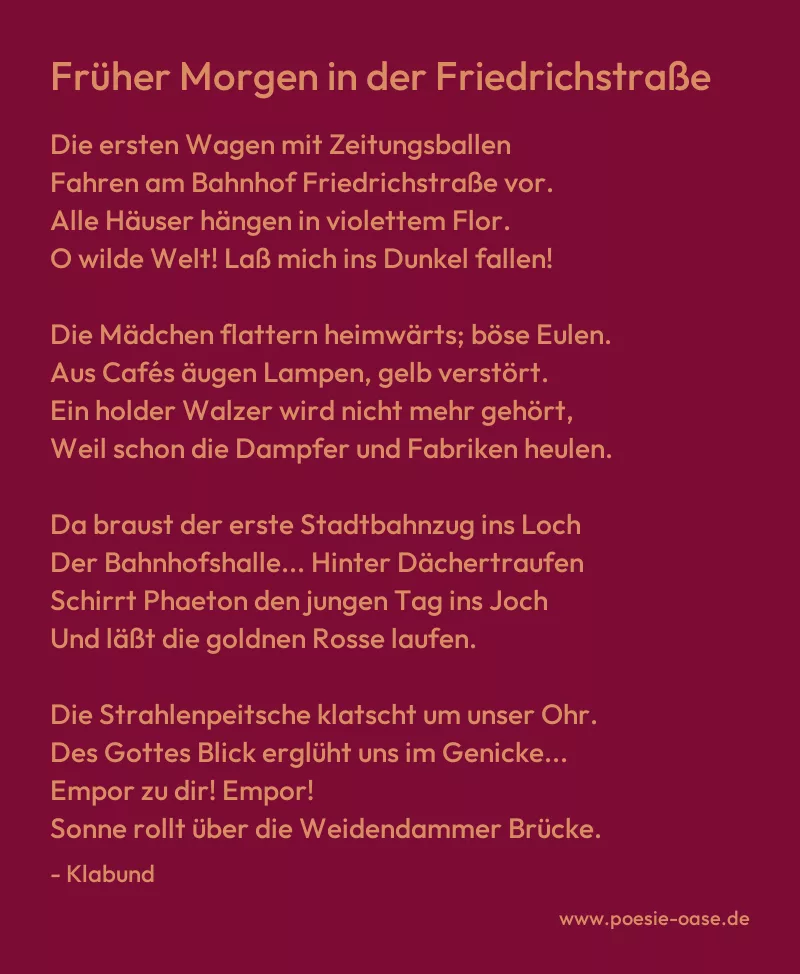
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Früher Morgen in der Friedrichstraße“ von Klabund zeichnet ein beeindruckendes Bild des Übergangs von der Nacht zum Tag in einer Großstadt, wobei es gleichzeitig eine tiefe Melancholie und eine Sehnsucht nach dem Dunklen ausdrückt. Das Gedicht beginnt mit einer nüchternen Beschreibung der frühen Morgenstunden und der ersten Aktivitäten in der Friedrichstraße, die durch die Anlieferung von Zeitungsballen am Bahnhof Friedrichstraße und die violette Morgenröte charakterisiert werden. Der Ausruf „O wilde Welt! Laß mich ins Dunkel fallen!“ deutet bereits auf die ambivalente Beziehung des lyrischen Ichs zur aufbrechenden Tageshelle und zur Betriebsamkeit der Stadt hin, ein Wunsch nach Rückzug und Ruhe.
Die zweite Strophe verstärkt diesen Kontrast. Die „Mädchen“, die aus den Cafés kommen, werden mit „bösen Eulen“ verglichen, ein klares Zeichen der Ablehnung des nächtlichen Treibens und der damit verbundenen Sinnlichkeit. Die „gelb verstörten“ Lampen und der Verlust des „holder[n] Walzer[s]“ signalisieren das Ende der Nacht und den Beginn der industriellen Geräusche, welche durch das „Heulen“ der Dampfer und Fabriken repräsentiert werden. Dies verdeutlicht die Zerrissenheit des lyrischen Ichs, das sich zwischen der Sehnsucht nach der Romantik der Nacht und der Realität des aufkommenden Tages bewegt.
In der dritten Strophe vollzieht sich ein dynamischer Wechsel. Der erste Stadtbahnzug, der in die Bahnhofshalle einfährt, symbolisiert den Einbruch der modernen, schnelllebigen Welt. Gleichzeitig wird der Tag personifiziert, indem „Phaeton“ (als Sinnbild für den Sonnengott) den jungen Tag „ins Joch“ spannt und seine „goldnen Rosse“ laufen lässt. Dieses Bild der Himmelsfahrt des Tages, das mit mythologischen Bezügen angereichert ist, kontrastiert mit der beklemmenden Atmosphäre der ersten beiden Strophen und suggeriert einen Aufbruch, der aber vom lyrischen Ich nicht ungeteilt begrüßt wird.
Die letzte Strophe schließt mit einer apokalyptischen Szene. Die Sonne, dargestellt als „Strahlenpeitsche“, trifft das lyrische Ich, das sich unter ihrem Blick empfindet. Der Ausruf „Empor zu dir! Empor!“ offenbart sowohl die Akzeptanz als auch die Überwältigung durch das Licht, welches auf der Weidendammer Brücke ihren Höhepunkt erreicht. Die Sonne repräsentiert hier nicht nur den Tag, sondern auch eine göttliche Präsenz, der sich das lyrische Ich unterwerfen muss, während es gleichzeitig in die neue Helligkeit und das kommende Tagesgeschehen katapultiert wird.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.