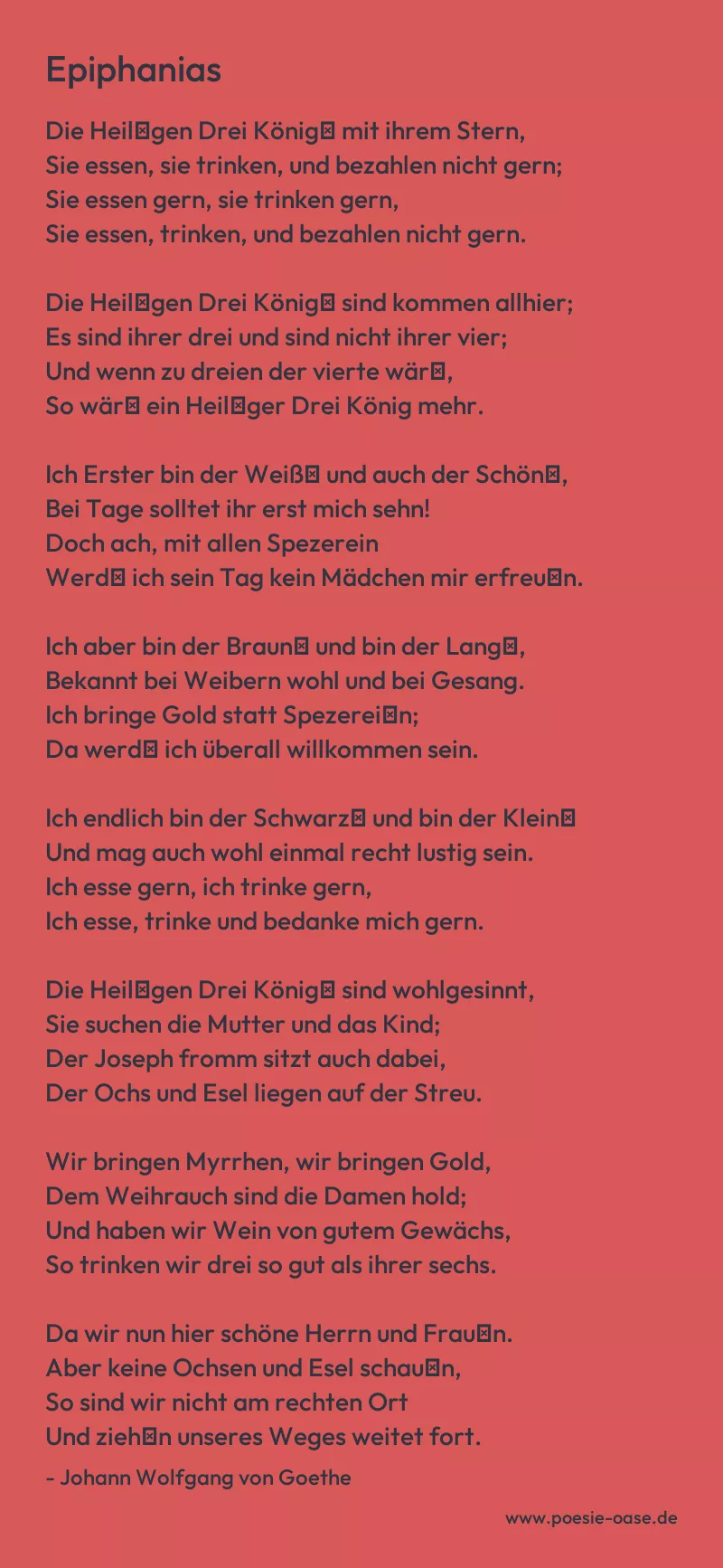Die Heil′gen Drei König′ mit ihrem Stern,
Sie essen, sie trinken, und bezahlen nicht gern;
Sie essen gern, sie trinken gern,
Sie essen, trinken, und bezahlen nicht gern.
Die Heil′gen Drei König′ sind kommen allhier;
Es sind ihrer drei und sind nicht ihrer vier;
Und wenn zu dreien der vierte wär′,
So wär′ ein Heil′ger Drei König mehr.
Ich Erster bin der Weiß′ und auch der Schön′,
Bei Tage solltet ihr erst mich sehn!
Doch ach, mit allen Spezerein
Werd′ ich sein Tag kein Mädchen mir erfreu′n.
Ich aber bin der Braun′ und bin der Lang′,
Bekannt bei Weibern wohl und bei Gesang.
Ich bringe Gold statt Spezerei′n;
Da werd′ ich überall willkommen sein.
Ich endlich bin der Schwarz′ und bin der Klein′
Und mag auch wohl einmal recht lustig sein.
Ich esse gern, ich trinke gern,
Ich esse, trinke und bedanke mich gern.
Die Heil′gen Drei König′ sind wohlgesinnt,
Sie suchen die Mutter und das Kind;
Der Joseph fromm sitzt auch dabei,
Der Ochs und Esel liegen auf der Streu.
Wir bringen Myrrhen, wir bringen Gold,
Dem Weihrauch sind die Damen hold;
Und haben wir Wein von gutem Gewächs,
So trinken wir drei so gut als ihrer sechs.
Da wir nun hier schöne Herrn und Frau′n.
Aber keine Ochsen und Esel schau′n,
So sind wir nicht am rechten Ort
Und zieh′n unseres Weges weitet fort.