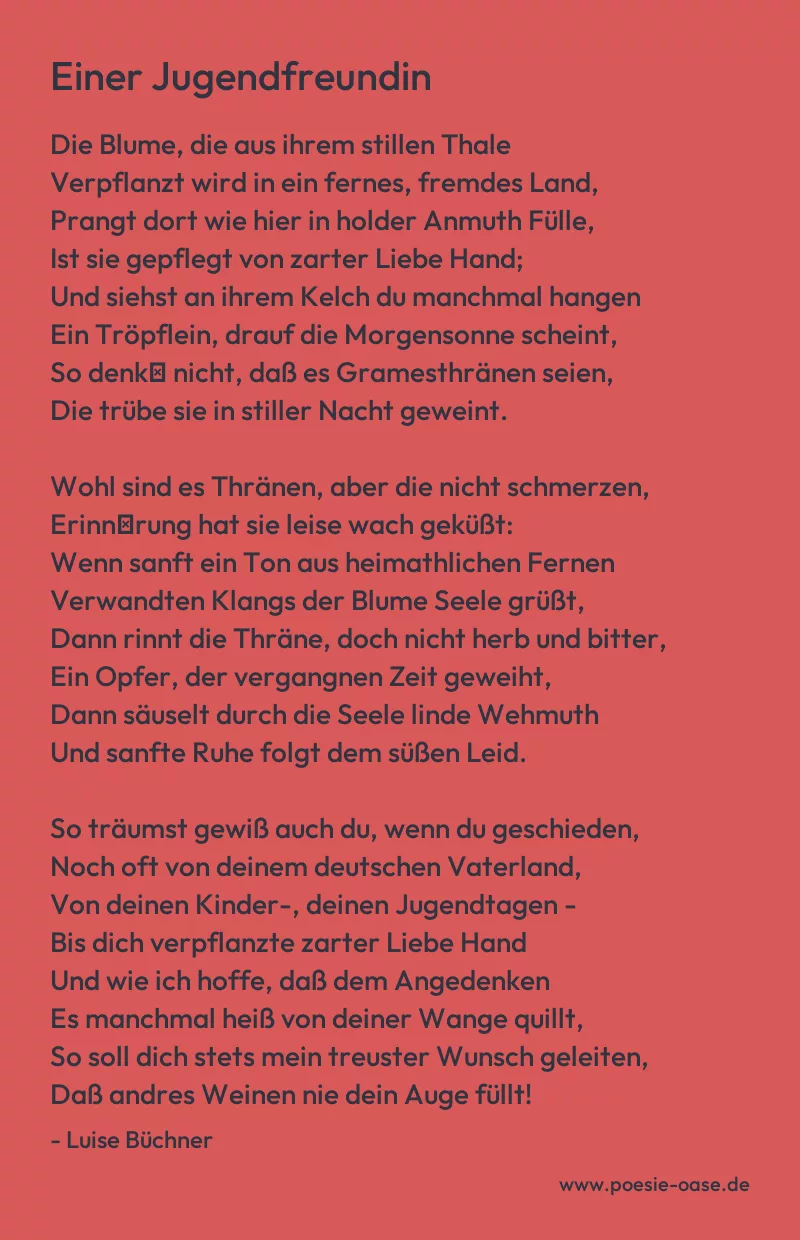Einer Jugendfreundin
Die Blume, die aus ihrem stillen Thale
Verpflanzt wird in ein fernes, fremdes Land,
Prangt dort wie hier in holder Anmuth Fülle,
Ist sie gepflegt von zarter Liebe Hand;
Und siehst an ihrem Kelch du manchmal hangen
Ein Tröpflein, drauf die Morgensonne scheint,
So denk′ nicht, daß es Gramesthränen seien,
Die trübe sie in stiller Nacht geweint.
Wohl sind es Thränen, aber die nicht schmerzen,
Erinn′rung hat sie leise wach geküßt:
Wenn sanft ein Ton aus heimathlichen Fernen
Verwandten Klangs der Blume Seele grüßt,
Dann rinnt die Thräne, doch nicht herb und bitter,
Ein Opfer, der vergangnen Zeit geweiht,
Dann säuselt durch die Seele linde Wehmuth
Und sanfte Ruhe folgt dem süßen Leid.
So träumst gewiß auch du, wenn du geschieden,
Noch oft von deinem deutschen Vaterland,
Von deinen Kinder-, deinen Jugendtagen –
Bis dich verpflanzte zarter Liebe Hand
Und wie ich hoffe, daß dem Angedenken
Es manchmal heiß von deiner Wange quillt,
So soll dich stets mein treuster Wunsch geleiten,
Daß andres Weinen nie dein Auge füllt!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
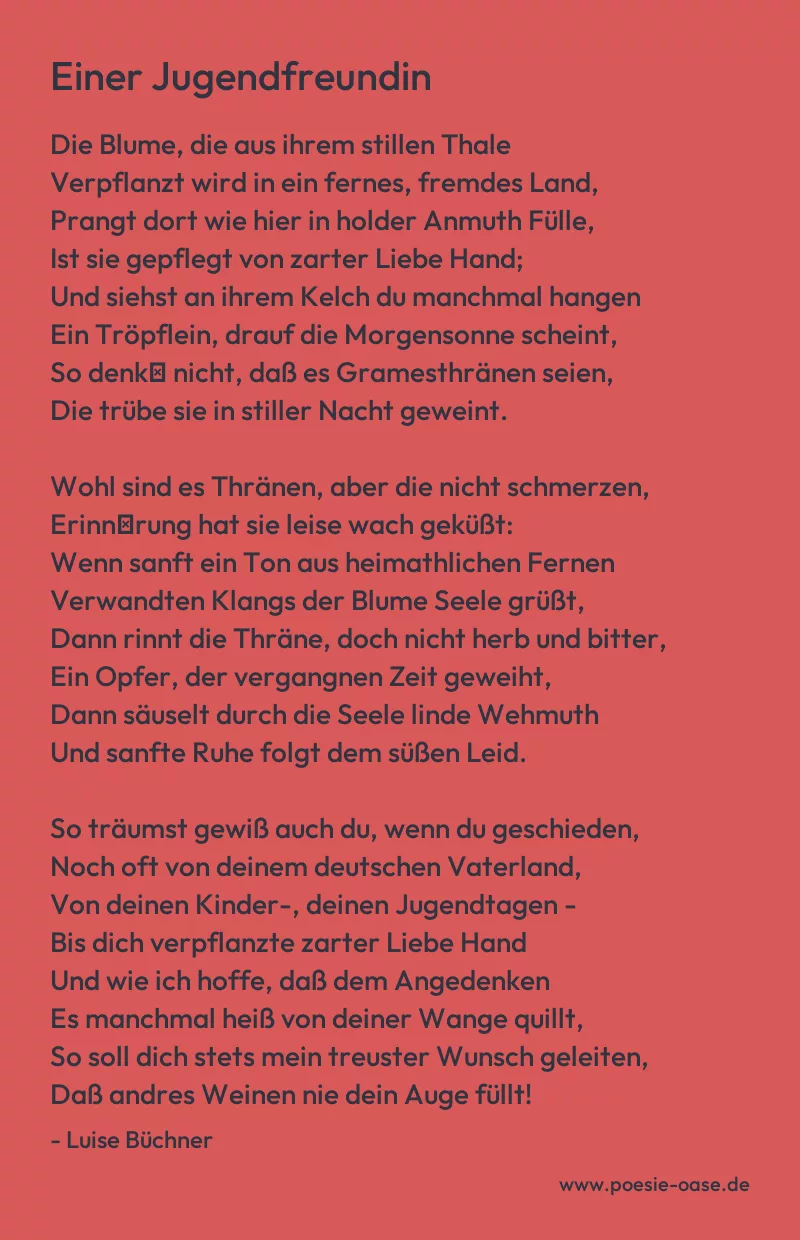
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Einer Jugendfreundin“ von Luise Büchner ist eine einfühlsame Betrachtung über die Verbundenheit mit der Heimat und die Erinnerung an vergangene Zeiten, besonders wenn man von dieser Heimat getrennt ist. Es nutzt das Bild einer Blume, die aus ihrem vertrauten Tal in eine neue, fremde Umgebung verpflanzt wird, als Metapher für das Leben im Exil oder die Trennung von der Jugend. Die Blume, trotz aller Veränderungen, behält ihre Schönheit und Anmut, vorausgesetzt, sie wird mit liebevoller Fürsorge behandelt. Diese liebevolle Hand symbolisiert hier vermutlich die Zuwendung der Freundin und die unterstützende Kraft der Erinnerung.
Im ersten Teil des Gedichts wird der Zustand der Blume in ihrer neuen Umgebung beschrieben. Die Tränen, die sie vergießt, werden nicht als Zeichen von Schmerz oder Trauer interpretiert, sondern als eine Erinnerung an die Vergangenheit. Ein kleines „Tröpflein“ Morgentau, das an den Blütenblättern hängt, wird als Metapher für die Tränen der Blume verwendet. Die Blume, gepflegt von zarter Liebe, erinnert sich an die Vergangenheit. Diese „Tränen“ sind nicht bitter, sondern Ausdruck der Wehmut und der Verbundenheit. Der Hinweis auf die Morgensonne, die sich in den Tränen spiegelt, verleiht dem Bild eine besondere Schönheit und unterstreicht die positive Konnotation der Erinnerung.
Der zweite Teil des Gedichts wendet sich direkt an die Jugendfreundin und überträgt die Metapher auf ihre eigene Situation. Die Dichterin geht davon aus, dass die Freundin, wie die Blume, auch in der Ferne oft an ihre deutsche Heimat und die gemeinsame Jugendzeit denken wird. Die Erinnerungen werden als sanfte Töne beschrieben, die die Seele der Freundin berühren und Erinnerungen wachrufen. Der Wunsch der Dichterin ist, dass die Freundin auch in der Trennung mit positiven Erinnerungen an die gemeinsame Vergangenheit verbunden bleibt.
Das Gedicht schließt mit einem tiefen Wunsch nach Glück und Zufriedenheit für die Freundin. Die Dichterin hofft, dass die Freundin, wie sie selbst, in der Lage sein wird, die Erinnerungen an die Heimat und die Jugend liebevoll zu bewahren und die Wehmut als eine Quelle sanfter Ruhe zu empfinden. Der letzte Vers, „Daß andres Weinen nie dein Auge füllt!“, ist ein Ausdruck der Hoffnung, dass die Freundin vor schwerem Leid bewahrt wird, und eine Betonung der Wichtigkeit, die positiven Erinnerungen zu bewahren. Das Gedicht ist somit eine liebevolle Botschaft der Verbundenheit, der Hoffnung und der sanften Erinnerung.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.