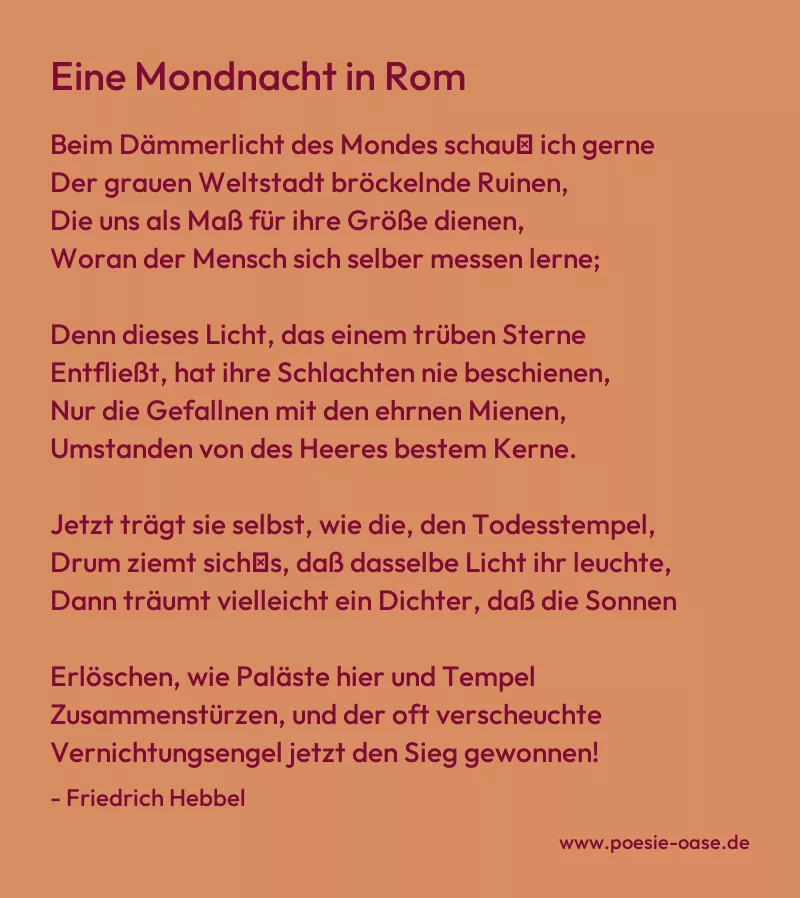Eine Mondnacht in Rom
Beim Dämmerlicht des Mondes schau′ ich gerne
Der grauen Weltstadt bröckelnde Ruinen,
Die uns als Maß für ihre Größe dienen,
Woran der Mensch sich selber messen lerne;
Denn dieses Licht, das einem trüben Sterne
Entfließt, hat ihre Schlachten nie beschienen,
Nur die Gefallnen mit den ehrnen Mienen,
Umstanden von des Heeres bestem Kerne.
Jetzt trägt sie selbst, wie die, den Todesstempel,
Drum ziemt sich′s, daß dasselbe Licht ihr leuchte,
Dann träumt vielleicht ein Dichter, daß die Sonnen
Erlöschen, wie Paläste hier und Tempel
Zusammenstürzen, und der oft verscheuchte
Vernichtungsengel jetzt den Sieg gewonnen!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
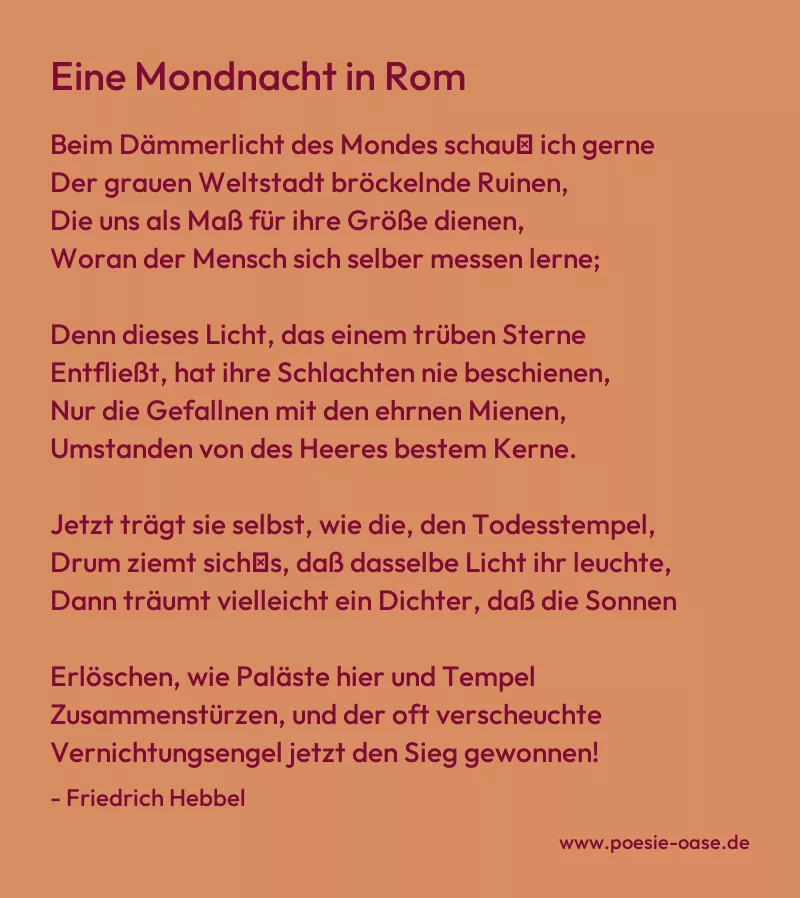
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Eine Mondnacht in Rom“ von Friedrich Hebbel ist eine Reflexion über die Vergänglichkeit menschlicher Größe und die unaufhaltsame Kraft des Verfalls, betrachtet vor dem Hintergrund der römischen Ruinen im Mondlicht. Das Gedicht beginnt mit der kontemplativen Betrachtung der zerfallenden Überreste einer einst mächtigen Stadt, wobei das Mondlicht als sanfter Beobachter dient. Die Verse laden den Leser ein, die Geschichte und den Untergang Roms als Spiegelbild der menschlichen Existenz zu betrachten, ein Ort, an dem der Mensch seine eigene Vergänglichkeit erkennen kann.
Die zweite Strophe fokussiert auf die Vergangenheit Roms, insbesondere auf seine Kriege und gefallenen Helden, die von dem gleichen Mondlicht erhellt werden, das jetzt die Ruinen beleuchtet. Diese Gegenüberstellung von einstiger militärischer Größe und dem aktuellen Verfall unterstreicht die Vergänglichkeit aller irdischen Macht. Die „ehrnen Mienen“ der Gefallenen und der „beste Kern“ des Heeres stehen im Kontrast zur Stille und dem Zerfall, die nun die Szene beherrschen. Das Mondlicht, das diese Szene beleuchtet, wird so zu einem Symbol der Unparteilichkeit und des ewigen Kreislaufs von Entstehung und Vergehen.
In der dritten Strophe wendet sich das Gedicht dem Thema der Zerstörung und des Untergangs zu, wobei die Ruinen als Träger des „Todesstempels“ bezeichnet werden. Der Dichter träumt von einer Welt, in der selbst die Sonnen erlöschen, was die ultimative Vorstellung von universeller Zerstörung darstellt. Der „Vernichtungsengel“, der nun den Sieg davonträgt, symbolisiert die unaufhaltsame Kraft des Verfalls, die sowohl für materielle als auch für metaphysische Strukturen gilt. Das Gedicht endet mit einer pessimistischen Vision, die die Nichtigkeit menschlicher Errungenschaften angesichts des unausweichlichen Endes betont.
Insgesamt ist „Eine Mondnacht in Rom“ ein melancholisches Gedicht, das durch die Schönheit der Natur – das Mondlicht – und die Schönheit der Ruinen – der Vergangenheit – die Themen Zeit, Tod und Vergänglichkeit erforscht. Hebbel nutzt die römischen Ruinen als Metapher für das menschliche Leben und die menschliche Zivilisation, die letztendlich dem Verfall und der Zerstörung unterliegen. Das Gedicht regt den Leser dazu an, über die eigene Sterblichkeit und die Bedeutung von Größe und Ruhm im Angesicht des Todes nachzudenken.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.