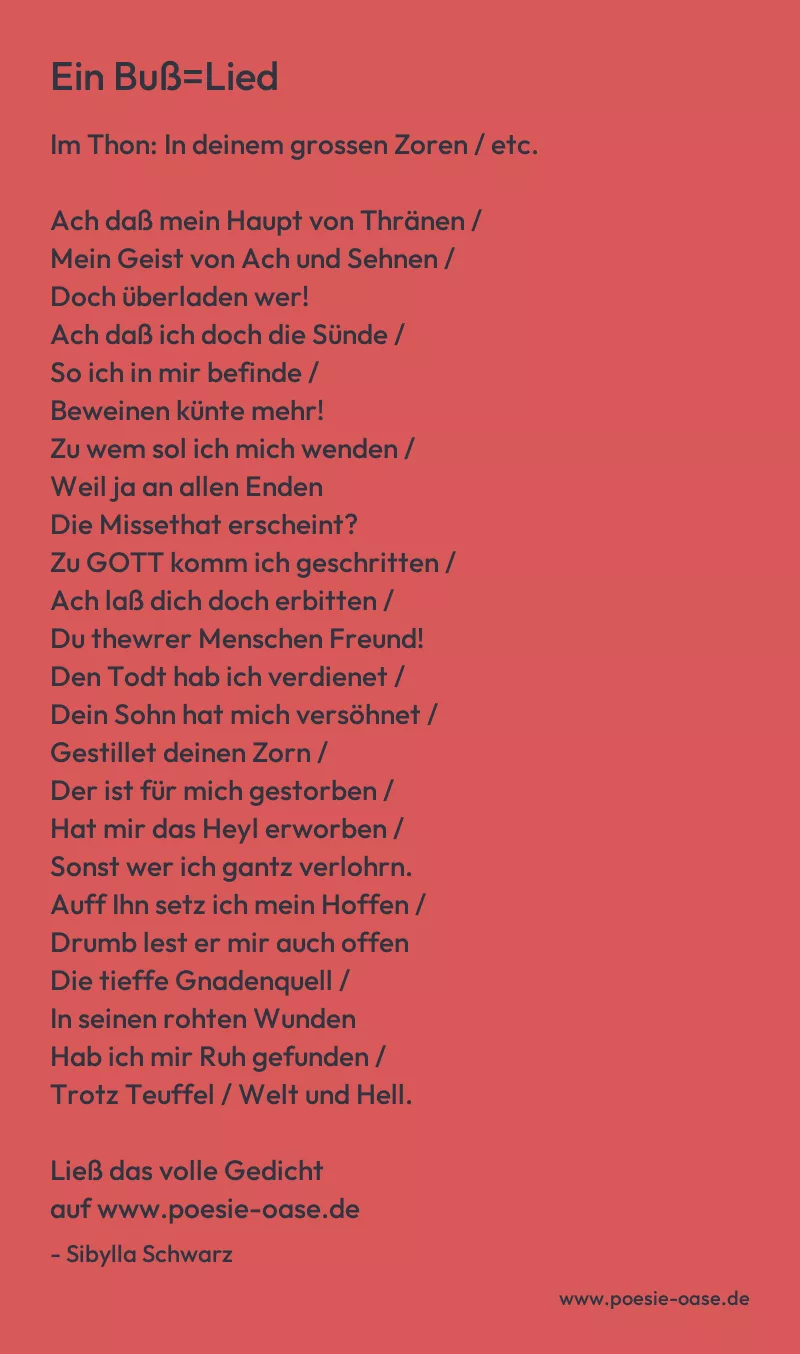Ein Buß=Lied
Im Thon: In deinem grossen Zoren / etc.
Ach daß mein Haupt von Thränen /
Mein Geist von Ach und Sehnen /
Doch überladen wer!
Ach daß ich doch die Sünde /
So ich in mir befinde /
Beweinen künte mehr!
Zu wem sol ich mich wenden /
Weil ja an allen Enden
Die Missethat erscheint?
Zu GOTT komm ich geschritten /
Ach laß dich doch erbitten /
Du thewrer Menschen Freund!
Den Todt hab ich verdienet /
Dein Sohn hat mich versöhnet /
Gestillet deinen Zorn /
Der ist für mich gestorben /
Hat mir das Heyl erworben /
Sonst wer ich gantz verlohrn.
Auff Ihn setz ich mein Hoffen /
Drumb lest er mir auch offen
Die tieffe Gnadenquell /
In seinen rohten Wunden
Hab ich mir Ruh gefunden /
Trotz Teuffel / Welt und Hell.
Du trewer Samariter /
Du Gnad= und Trost=Anbieter /
Dich bitt ich inniglich:
Du wollest mir doch geben
Ein gantz gebesserts Leben /
So will ich preisen dich.
Dein Lob sol bey mir klingen /
Ich wil dir Opfer bringen;
Bey dir wird nur verlacht
Der hohen Wörter Prangen /
Du trägst allein Verlangen
Nach fewriger Andacht.
Drumb laß dir doch belieben
Was ich allhier geschrieben /
Behüte mich hinfort /
Laß mich in Sünd nicht stecken /
Sonst würde mich erschrecken
Der Hellen weite Pfort!
Und wenn nun meine Seele
Auß diser finstern Höle
Des Leibes weichen sol /
So wolst du bey mir stehen /
Und nimmer von mir gehen /
So ist mir ewig wol.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
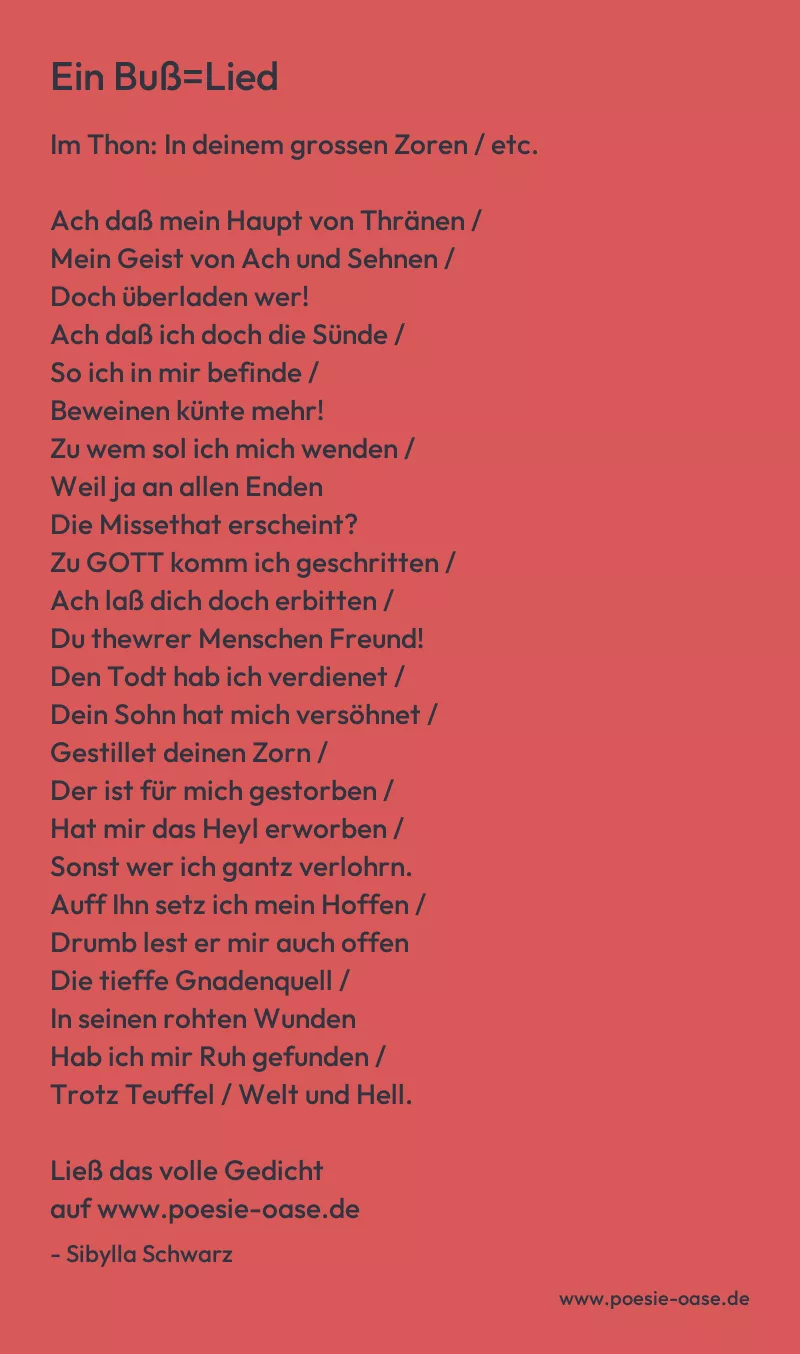
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Ein Buß=Lied“ von Sibylla Schwarz ist ein ergreifendes Bekenntnis der Reue und des Glaubens, das die Leser in die Seele einer gläubigen Person blicken lässt, die um Vergebung fleht. Das Gedicht ist in der Barockzeit entstanden und spiegelt die religiöse Frömmigkeit und das Empfinden der Sünde wider, die in dieser Epoche vorherrschend waren. Die Dichterin drückt ihre tiefe Trauer über ihre Sünden aus und wendet sich in einem Gebet direkt an Gott, um Gnade und Trost zu erbitten.
Das Gedicht beginnt mit einer Beschreibung der Reue und des Schmerzes der Sprecherin, die ihre Tränen und ihre Sehnsucht nach Erlösung erwähnt. Sie fragt sich, wie sie ihre Sünden beweinen kann, und erkennt die Allgegenwart der Sünde. Die Hinwendung zu Gott als dem Freund der Menschen ist ein zentrales Element. Die Sprecherin erkennt ihre eigene Unwürdigkeit, da sie den Tod verdient hat, aber sie findet Trost in der Versöhnung durch Jesus Christus, der für ihre Sünden gestorben ist. Dies ist ein typischer Ausdruck des protestantischen Glaubens, der die Erlösung durch den Glauben betont.
Der zweite Teil des Gedichts bekräftigt das Vertrauen auf Gott. Die Sprecherin setzt ihre Hoffnung auf ihn und dankt ihm für die Gnade, die sie durch die Wunden Jesu findet. Dies führt zu einem Gefühl des Friedens und der Ruhe, das sich gegen die Mächte des Bösen richtet. Das Gedicht nimmt die Form eines Gebets an, in dem die Sprecherin Gott bittet, ihr ein besseres Leben zu schenken. Sie verspricht, Gott zu preisen und ihm Opfer darzubringen, was ein Ausdruck ihrer Dankbarkeit und Hingabe ist.
Der Schluss des Gedichts widmet sich der Hoffnung auf das ewige Leben. Die Sprecherin bittet Gott um Schutz vor der Sünde und vor der Hölle. Sie hofft, dass Gott sie im Todeskampf beistehen wird und sie niemals verlassen wird. Das Versprechen des ewigen Wohls ist ein Ausdruck des christlichen Glaubens an die Auferstehung und das ewige Leben im Himmel. Die Verwendung von Bildern wie „tieffe Gnadenquell“, „rohten Wunden“, „Hell“ und „finsteren Höle“ verstärkt die emotionale Wirkung des Gedichts und verdeutlicht die Intensität des Glaubens und der Hoffnung der Sprecherin.
Zusammenfassend ist „Ein Buß=Lied“ ein tiefgründiges religiöses Gedicht, das die Themen Reue, Vergebung, Glaube und Hoffnung miteinander verwebt. Es bietet einen Einblick in die tiefe Frömmigkeit der Autorin und zeugt von ihrem festen Glauben an Gott und die Erlösung durch Jesus Christus. Das Gedicht ist ein eindringliches Beispiel für die religiöse Lyrik des Barock und spiegelt die spirituellen Sehnsüchte und die existenzielle Unsicherheit jener Zeit wider.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.