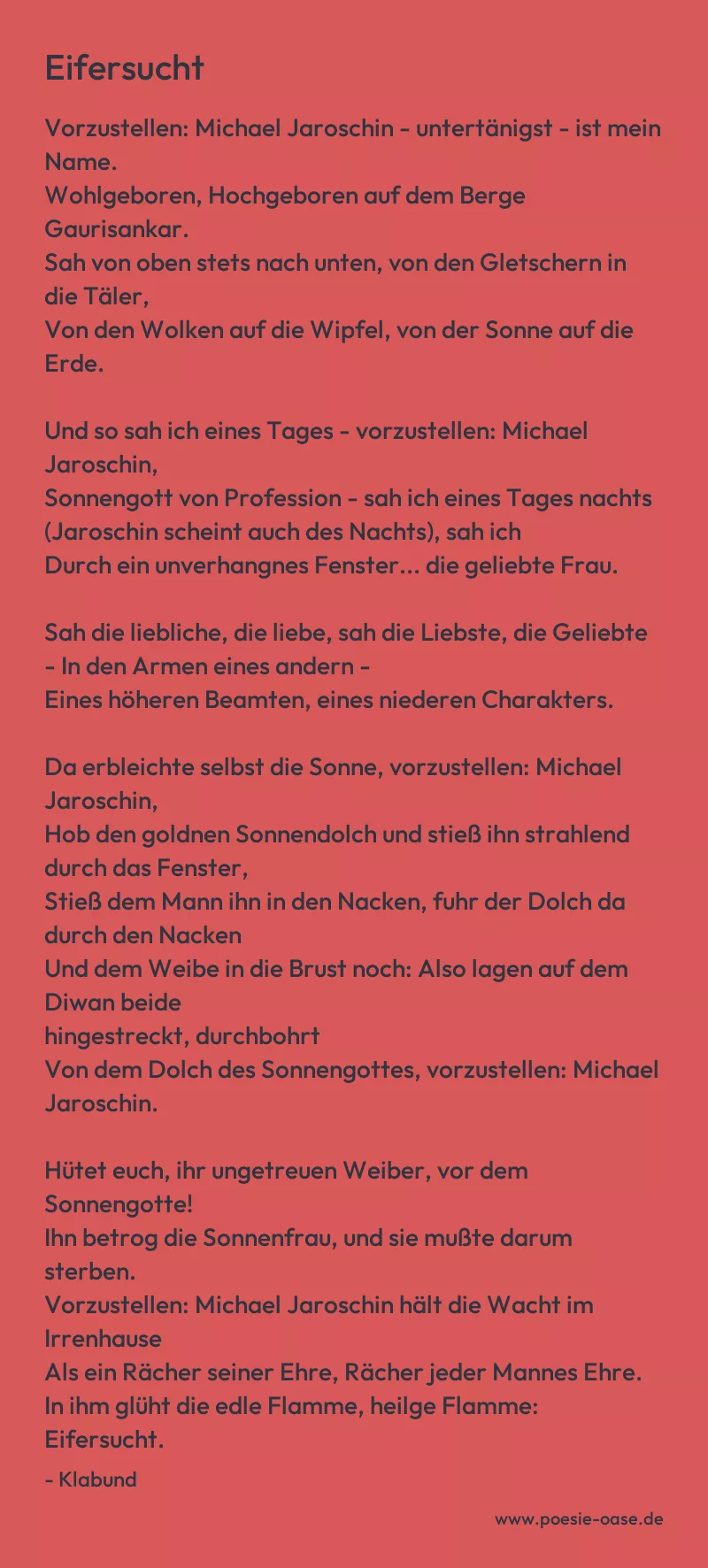Vorzustellen: Michael Jaroschin – untertänigst – ist mein Name.
Wohlgeboren, Hochgeboren auf dem Berge Gaurisankar.
Sah von oben stets nach unten, von den Gletschern in die Täler,
Von den Wolken auf die Wipfel, von der Sonne auf die Erde.
Und so sah ich eines Tages – vorzustellen: Michael Jaroschin,
Sonnengott von Profession – sah ich eines Tages nachts
(Jaroschin scheint auch des Nachts), sah ich
Durch ein unverhangnes Fenster… die geliebte Frau.
Sah die liebliche, die liebe, sah die Liebste, die Geliebte
– In den Armen eines andern –
Eines höheren Beamten, eines niederen Charakters.
Da erbleichte selbst die Sonne, vorzustellen: Michael Jaroschin,
Hob den goldnen Sonnendolch und stieß ihn strahlend durch das Fenster,
Stieß dem Mann ihn in den Nacken, fuhr der Dolch da durch den Nacken
Und dem Weibe in die Brust noch: Also lagen auf dem Diwan beide
hingestreckt, durchbohrt
Von dem Dolch des Sonnengottes, vorzustellen: Michael Jaroschin.
Hütet euch, ihr ungetreuen Weiber, vor dem Sonnengotte!
Ihn betrog die Sonnenfrau, und sie mußte darum sterben.
Vorzustellen: Michael Jaroschin hält die Wacht im Irrenhause
Als ein Rächer seiner Ehre, Rächer jeder Mannes Ehre.
In ihm glüht die edle Flamme, heilge Flamme: Eifersucht.