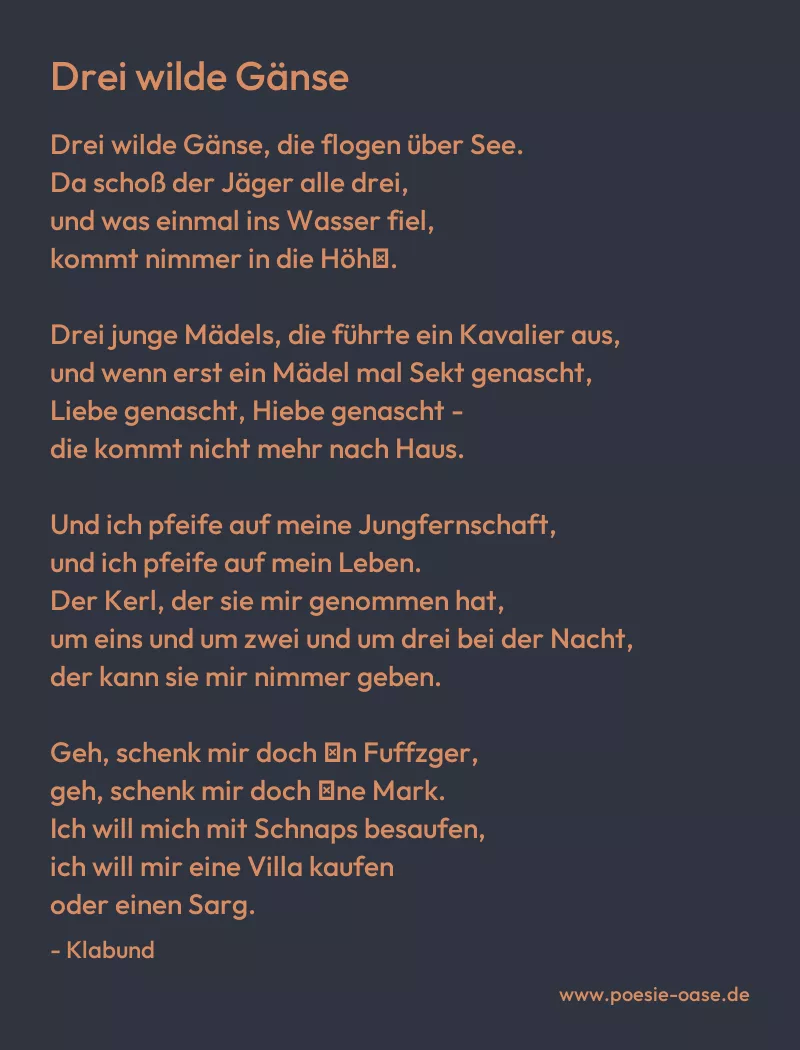Drei wilde Gänse
Drei wilde Gänse, die flogen über See.
Da schoß der Jäger alle drei,
und was einmal ins Wasser fiel,
kommt nimmer in die Höh′.
Drei junge Mädels, die führte ein Kavalier aus,
und wenn erst ein Mädel mal Sekt genascht,
Liebe genascht, Hiebe genascht –
die kommt nicht mehr nach Haus.
Und ich pfeife auf meine Jungfernschaft,
und ich pfeife auf mein Leben.
Der Kerl, der sie mir genommen hat,
um eins und um zwei und um drei bei der Nacht,
der kann sie mir nimmer geben.
Geh, schenk mir doch ′n Fuffzger,
geh, schenk mir doch ′ne Mark.
Ich will mich mit Schnaps besaufen,
ich will mir eine Villa kaufen
oder einen Sarg.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
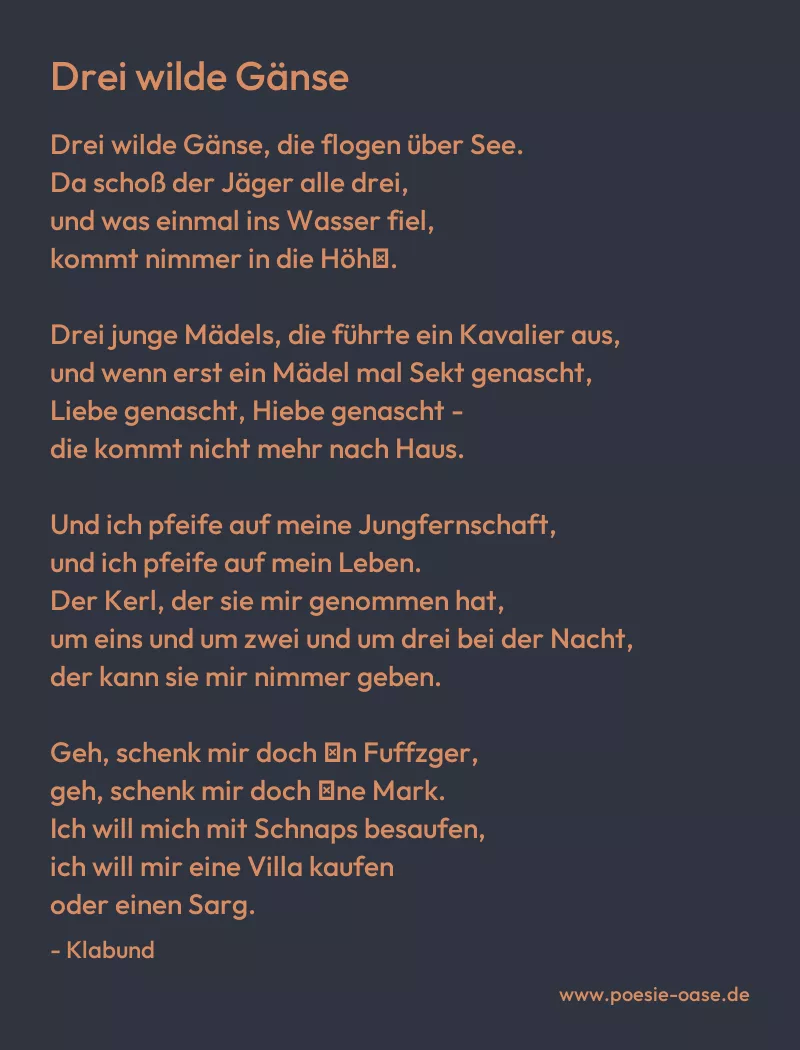
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Drei wilde Gänse“ von Klabund ist eine düstere Ballade, die auf bemerkenswerte Weise zwei scheinbar unabhängige Geschichten miteinander verwebt, um eine allgemeine Tragödie des Verlusts und der Zerstörung zu illustrieren. Es beginnt mit einer schlichten, bildhaften Beschreibung des Schießens von drei wilden Gänsen, was sofort das Motiv des Todes und des unwiderruflichen Verlusts etabliert. Die Wiederholung der Zahl „drei“ und die kurze, prägnante Sprache verstärken die Tragik des Verlustes, der mit dem Sterben der Gänse assoziiert ist.
Der zweite Abschnitt spiegelt diese Tragödie in einer vergleichenden Analogie wider. Hier wird der Verlust von drei jungen Frauen durch einen Kavalier beschrieben, der sie „ausführt“. Die Verwendung von Wörtern wie „Sekt genascht“, „Liebe genascht“, und „Hiebe genascht“ deutet auf eine Erfahrung hin, die das Leben der Frauen dauerhaft verändert und sie vom Weg der Unschuld abbringt. Die Zeile „die kommt nicht mehr nach Haus“ dient als eindringliche Wiederholung des ersten Abschnitts und unterstreicht die Unwiederbringlichkeit des Verlustes, der durch die Ereignisse im Leben der Mädchen verursacht wird.
Der dritte Teil des Gedichts ist der ergreifendste und persönlichste. Die Ich-Erzählerin bekennt ihre verlorene „Jungfernschaft“ und das Gefühl, ihr Leben verloren zu haben. Die Verzweiflung der Erzählerin manifestiert sich in der Frage nach demjenigen, der ihr genommen hat, was sie einst besaß. Die Wiederholung des Wortes „nimmer“ intensiviert das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und des endgültigen Verlustes. Dies ist der Kern der Tragödie, das Geständnis derjenigen, die direkt von den Konsequenzen betroffen sind.
Der abschließende Teil des Gedichts ist ein dramatisches Crescendo des Verfalls und der Verzweiflung. Die Erzählerin bittet um Geld, um sich zu betrinken oder einen Sarg zu kaufen, was das ganze Ausmaß ihrer Depression und Verzweiflung widerspiegelt. Der Wunsch, sich zu betrinken, zeigt den Wunsch, der Realität zu entfliehen, während der Wunsch nach einem Sarg die ultimative Resignation gegenüber dem Leben und dem Tod darstellt. Klabunds Gedicht ist also eine erschreckende Erkundung der Themen Verlust, Zerstörung und der Unumkehrbarkeit bestimmter menschlicher Erfahrungen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.