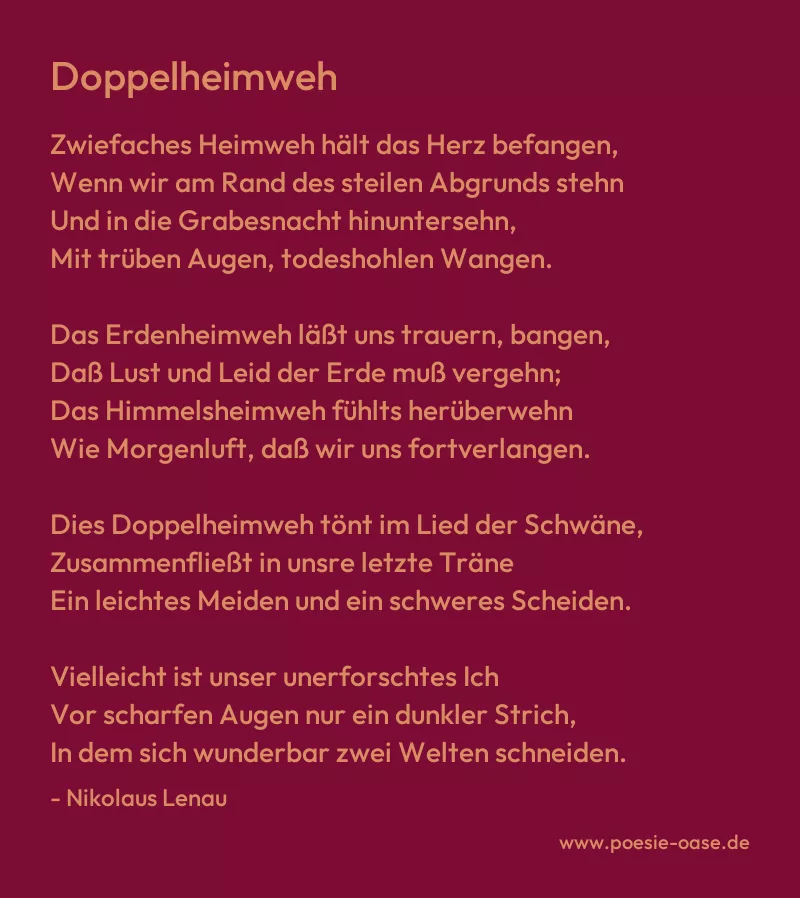Doppelheimweh
Zwiefaches Heimweh hält das Herz befangen,
Wenn wir am Rand des steilen Abgrunds stehn
Und in die Grabesnacht hinuntersehn,
Mit trüben Augen, todeshohlen Wangen.
Das Erdenheimweh läßt uns trauern, bangen,
Daß Lust und Leid der Erde muß vergehn;
Das Himmelsheimweh fühlts herüberwehn
Wie Morgenluft, daß wir uns fortverlangen.
Dies Doppelheimweh tönt im Lied der Schwäne,
Zusammenfließt in unsre letzte Träne
Ein leichtes Meiden und ein schweres Scheiden.
Vielleicht ist unser unerforschtes Ich
Vor scharfen Augen nur ein dunkler Strich,
In dem sich wunderbar zwei Welten schneiden.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
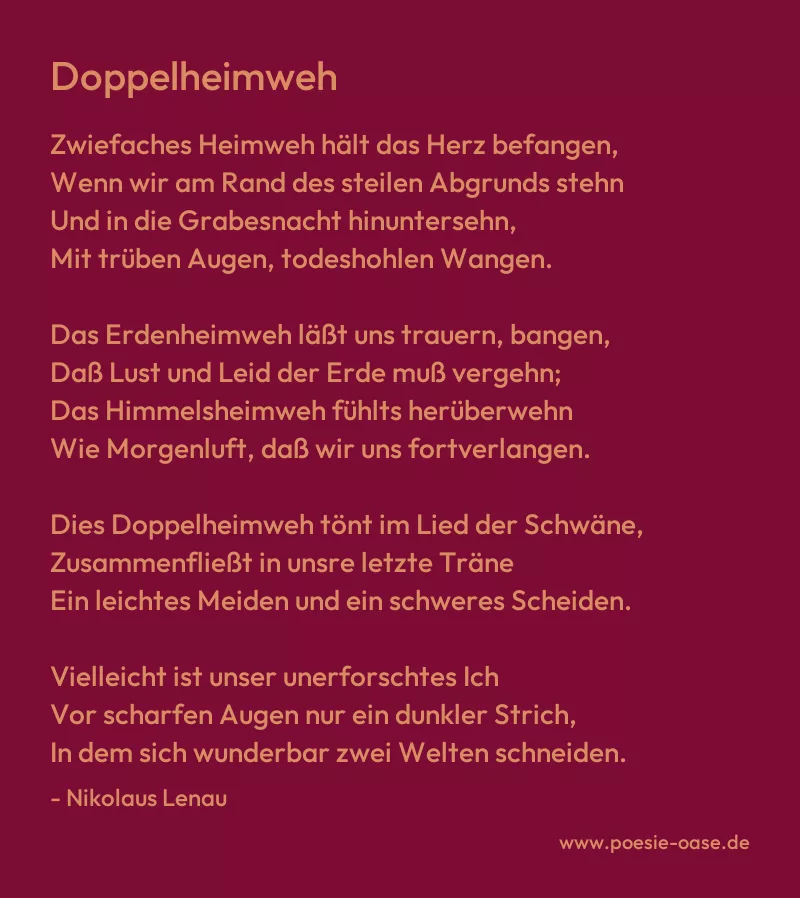
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Doppelheimweh“ von Nikolaus Lenau lotet auf bewegende Weise die tiefen Sehnsüchte und die existenzielle Zerrissenheit des Menschen aus. Es ist ein Gedicht, das von einem zweifachen Heimweh handelt, das das Herz des lyrischen Ichs gefangen hält. Das Gedicht zeichnet sich durch eine melancholische Grundstimmung aus, die durch die Thematisierung von Tod, Vergänglichkeit und dem Sehnen nach einer anderen Welt unterstrichen wird. Lenau gelingt es, die Ambivalenz dieser Gefühle durch eine präzise Bildsprache und eine geschickte Verwendung von Gegensätzen einzufangen.
Das erste Quartett beschreibt das Gefühl der Beengtheit, das durch das doppelte Heimweh ausgelöst wird. Der „steile Abgrund“ und die „Grabesnacht“ suggerieren eine Konfrontation mit dem Tod und der Vergänglichkeit des irdischen Lebens. Die „trüben Augen“ und „todeshohlen Wangen“ visualisieren die körperliche Verfassung des leidenden Ichs, das unter der Last der Sehnsucht zu zerbrechen droht. Die Metapher des „doppelten Heimwehs“ verdeutlicht, dass es sich nicht nur um die Sehnsucht nach der verlorenen Heimat auf Erden handelt, sondern auch um eine Sehnsucht nach einer anderen, himmlischen Existenz.
In der zweiten Strophe entfaltet sich die Natur dieser beiden Sehnsüchte weiter. Das „Erdenheimweh“ wird als Trauer über das Vergehen von „Lust und Leid“ auf Erden beschrieben, während das „Himmelsheimweh“ als sanftes „Herüberwehen“ wahrgenommen wird, das das Ich nach einer anderen Existenz verlangen lässt. Die Gegenüberstellung von irdischem Verlust und himmlischer Sehnsucht unterstreicht die innere Zerrissenheit des lyrischen Ichs. Das Bild der „Morgenluft“ suggeriert dabei eine Hoffnung auf Erneuerung und eine transzendente Erfahrung.
Die abschließende Terzine greift diese Thematik auf und kulminiert in der Erkenntnis der Einheit von „Meiden und Scheiden“. Das Bild der „Schwäne“ im „Lied der Schwäne“ evoziert eine romantische Vorstellung von Abschied und Tod, während die „letzte Träne“ das Gefühl der Verzweiflung und des Abschieds verdeutlicht. Die abschließenden Verse bieten einen spekulativen Ausblick auf die Natur des menschlichen Ichs. Sie suggerieren, dass das „unerforschte Ich“ als ein Schnittpunkt zweier Welten betrachtet werden kann. Diese Zeilen deuten eine tiefe philosophische Reflexion über die Natur von Leben, Tod und der Existenz eines übergeordneten Sinns an.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.