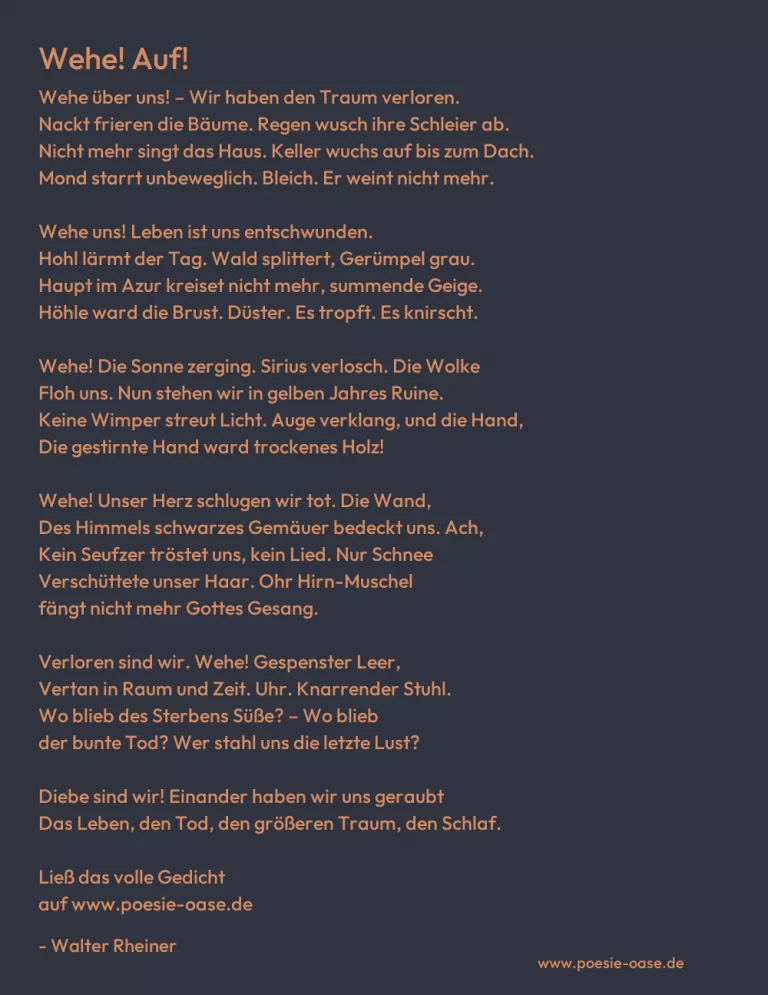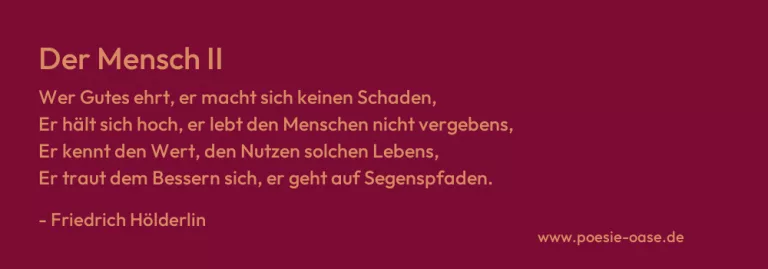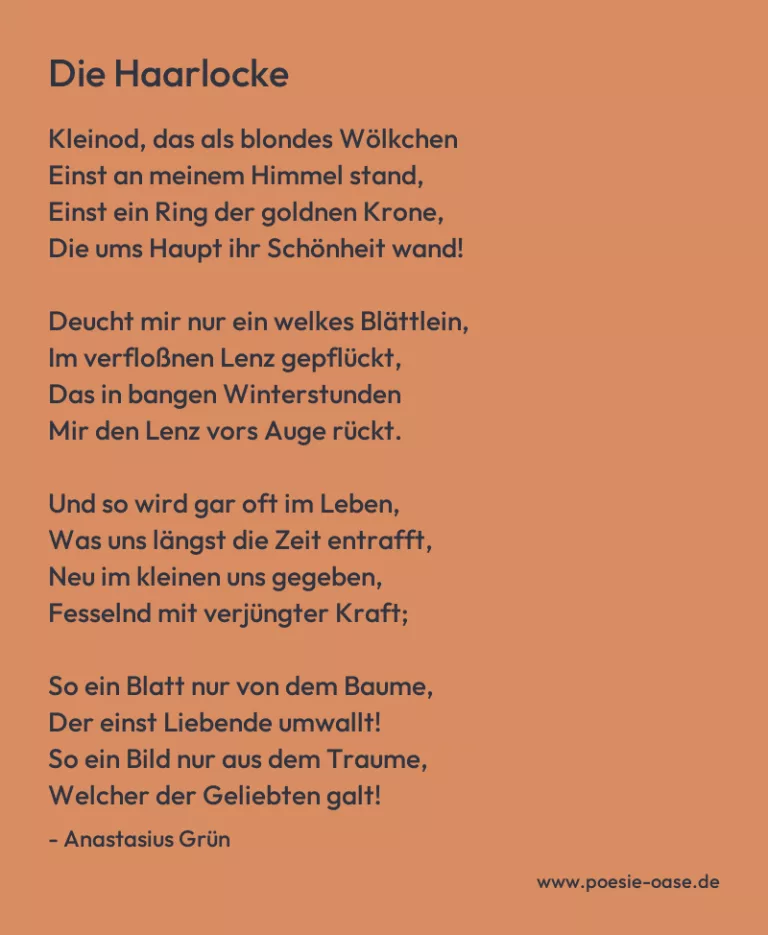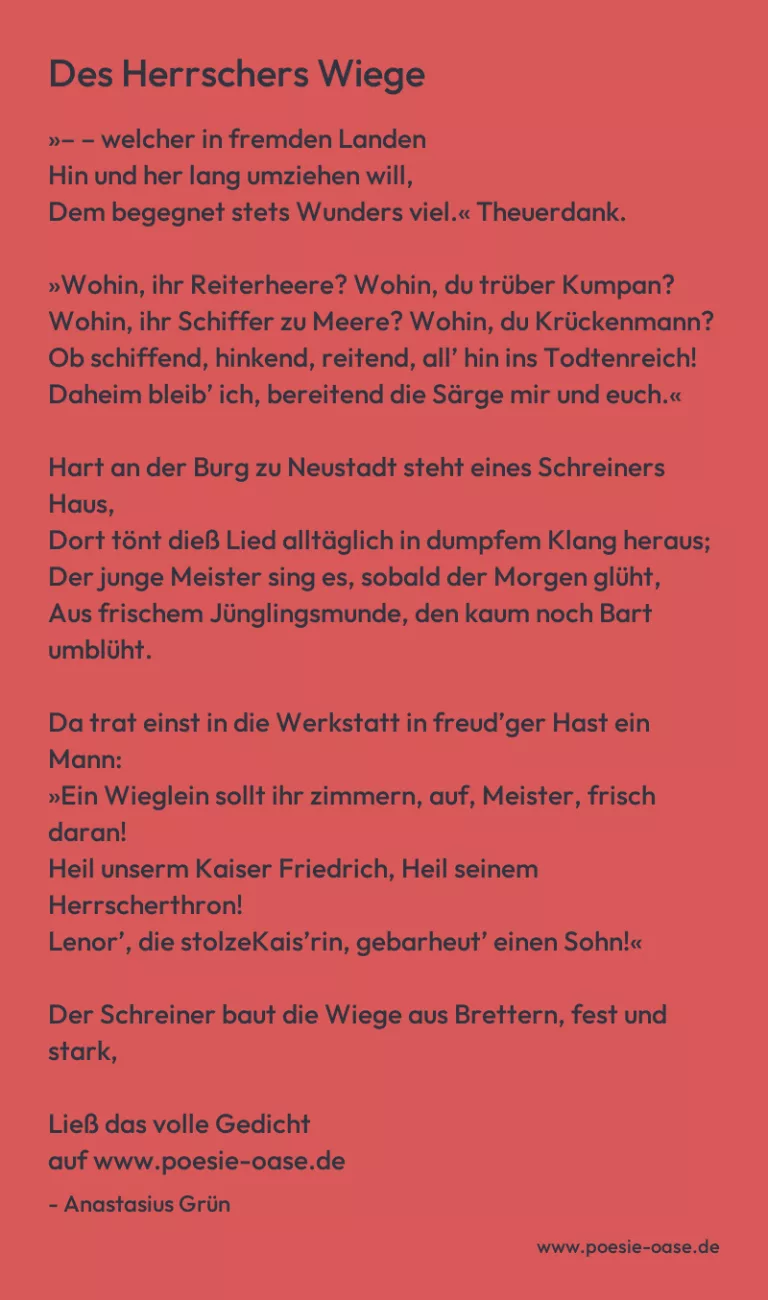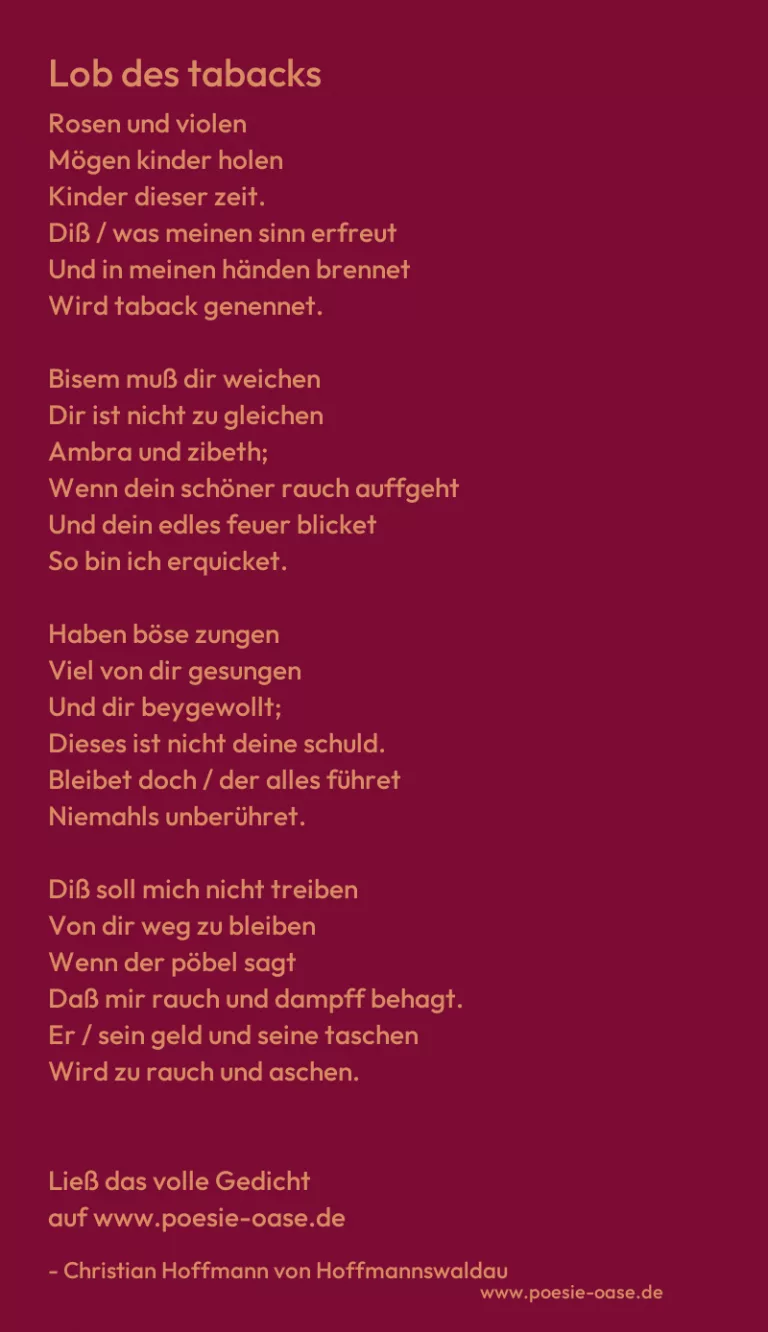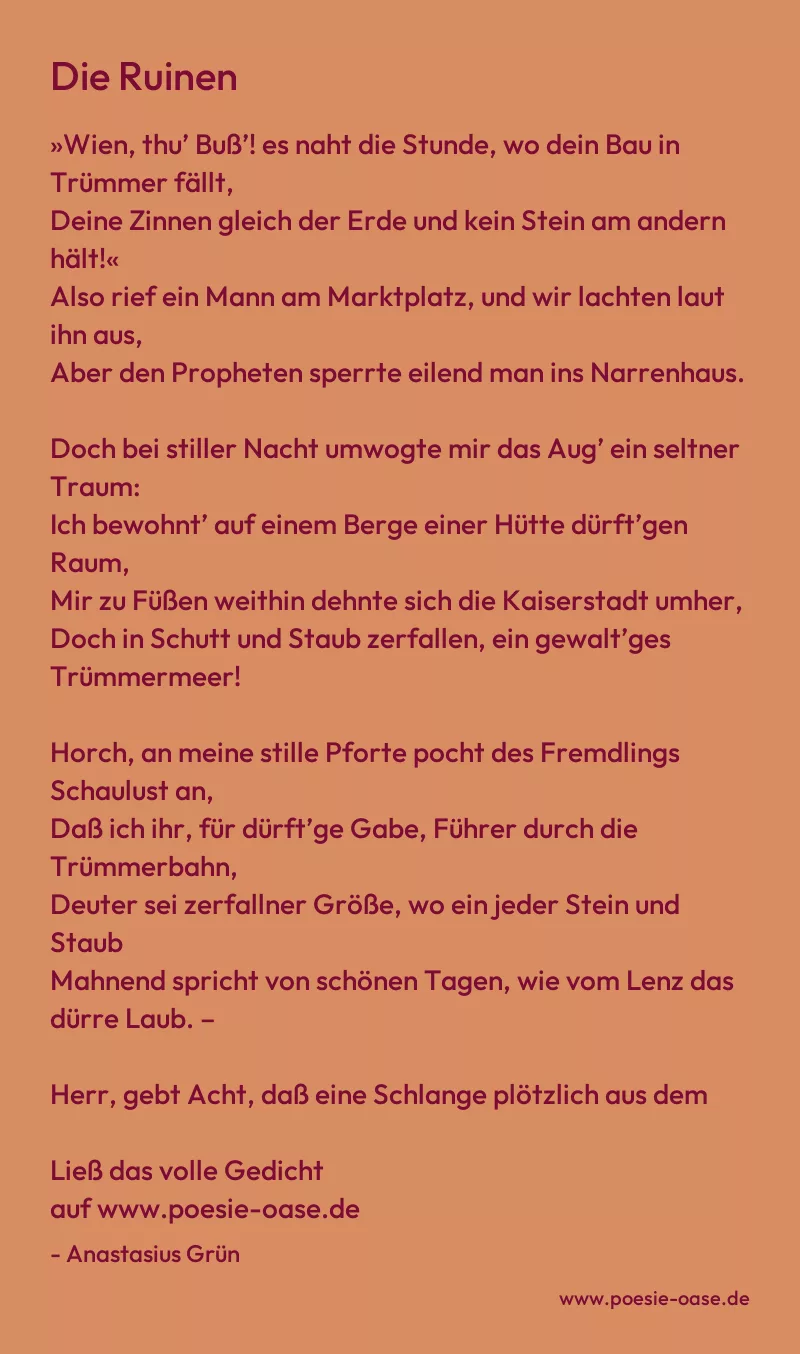»Wien, thu’ Buß’! es naht die Stunde, wo dein Bau in Trümmer fällt,
Deine Zinnen gleich der Erde und kein Stein am andern hält!«
Also rief ein Mann am Marktplatz, und wir lachten laut ihn aus,
Aber den Propheten sperrte eilend man ins Narrenhaus.
Doch bei stiller Nacht umwogte mir das Aug’ ein seltner Traum:
Ich bewohnt’ auf einem Berge einer Hütte dürft’gen Raum,
Mir zu Füßen weithin dehnte sich die Kaiserstadt umher,
Doch in Schutt und Staub zerfallen, ein gewalt’ges Trümmermeer!
Horch, an meine stille Pforte pocht des Fremdlings Schaulust an,
Daß ich ihr, für dürft’ge Gabe, Führer durch die Trümmerbahn,
Deuter sei zerfallner Größe, wo ein jeder Stein und Staub
Mahnend spricht von schönen Tagen, wie vom Lenz das dürre Laub. –
Herr, gebt Acht, daß eine Schlange plötzlich aus dem Schutt nicht blitzt!
Seht euch vor, daß ihr die Glieder nicht am Dorngestrüpp’ dort ritzt!
Reicht mir jetzt die Hand! Beschwerlich steigt durchs Schuttgeröll sich’s hier!
Auf dem Trümmerhügel finden doch ein Bischen Aussicht wir!
Seht euch um, ob’s einem Buche hoher Psalmen hier nicht gleicht,
Dran die Zeit das Blatt zermorschte und die ganze Schrift gebleicht,
Hier und dort nur blieben Wände, wie manch einzeln lesbar Wort,
Und gleichwie ein einzler Buchstab’ eine Säule hier und dort.
Rathet doch, wo jetzt wir stehen? – Ei nun, auf dem Stephansthurm!
Von der hohen Himmelspappel, die gefällt der grimme Sturm,
Ist’s zwar nur der niedre Strunk noch, der im Boden wurzelnd steht;
Denn der Stamm, die Zweig’ und Blätter liegen rings als Schutt gesät!
Schlank und stolz einst, wie die Pappel, stieg in Wolken er hinein,
Leichtes Ast- und Laubwerk formte Menschengeist aus sprödem Stein!
O wie zwischen Zweig’ und Blättern, hoch mit lautem hellem Schall
Oben die gewalt’ge Glocke schlug als Riesennachtigall!
Seht den Stein, bemoost am Boden! Wer wohl nähm’ an ihm es wahr,
Daß er Bruderschaft und Zwiesprach hielt in Lüften mit dem Aar!
Doch im Raum noch, wo der Aether tausend Jahr’ fast nicht gekreist,
Ragt als leise licht’re Säule, sichtbar kaum, des Thurmes Geist! –
Hebt empor euch auf den Zehen! Könnt ihr jene Eichen sehn,
Die wie Reihn von Grenadieren jenseits an der Donau stehn?
Herr, das hießen sie den Prater! Gegen jeden Schmerz und Tort
Wuchs dem guten heitren Völklein als Arznei ein Kräutlein dort.
Gegen bittrer Sorgen Wermut: dort des süßen Weines Trost!
Gegen Kapuzinerpredigt: des Hanswursts gesundre Kost!
Gegen Finsterniß von oben: dort von oben Sonnenschein!
Gegen düstre Gaunereien: fröhlich heitre Gaukelei’n! –
Laßt uns fort nun, aber sachte durch die wilden Rosen gehn,
Daß wir nimmer sie zertreten! Rosen stehn selbst Trümmern schön!
Schutt auf Schutt! – So mag’s geschehen, daß wir ließen ungegrüßt
Manch ein Grab, das unsrer Liebe, unsrer Thränen würdig ist!
Schnell vorbei an den zerfallnen Wohnungen der Gleißnerei!
An gewaltiger Paläste stolzem Wracke schnell vorbei!
Dessen Ueberrest zu stürzen, so wie seine Herren droht,
Deren ganzes langes Leben nur ein Warten auf den Tod!
Dort aus hohem Fenster nieder blickt des Epheus dicht Gesträuch,
Wie einst draus der Kanzler blickte, dessen Thun dem Epheu gleich:
Schlingkraut nur, das morsche Wände mühsam wohl zusammenhält,
Aber nie voll edler Blüthen, eigner freier Früchte schwellt!
Dort die Trümmer eines Klosters! – Aber laßt uns schnell vorbei!
Denn wer weiß, ob in die Steine nicht der Geist gefahren sei
Jener Männer, die im Weltall dulden ihre Art allein,
Und wir so in Stein urplötzlich könnten nicht verwandelt sein!
Seht das Grabgewölb’ der Kaiser, wo, von Mönchen treu bewacht,
Sie im Bett metallner Särge schlafen durch die ew’ge Nacht!
Seht dort in der Kutte sitzen das Geripp’ mit weißem Bart!
In der letzten Wächterstunde schlief’s wohl ein nach Wächterart!
Friede diesen dunklen Hallen! Traun kein schmähend, lieblos Wort
Trüb’ als böser Hauch der Särge blanke Kupferspiegel dort!
Rosen blüh’n ins Fürstenleben ja so selten nur hinein,
Höchstens ihre Särge schmückend, und selbst da – aus Erz und Stein!
Jene mächt’gen Fundamente, deren Quadern rings zerstückt,
Als Palast der Landesväter ragten einst sie reich geschmückt;
Ach, es mag so Mancher meinen gut sein Vateramt bestellt,
Wenn er nur ein Volk von Männern, Kindern gleich, in Windeln hält!
Wie gekrümmt Gewürm und Eidechs durch den Schutt jetzt kriecht und steigt,
Kroch einst zwischen diesen Steinen Schranzenbrut, schmiegsam verneigt!
Krumme Rücken rings und Kratzfuß! Ei, was Wunder, wenn am End’
Selbst die alten Mauern machten tief ihr furchtbar Kompliment!
Seht den Steinblock! Josephs Namen trägt noch der geborst’ne Schild;
Längst von den granitnen Stufen fiel das ehrne Reiterbild,
Das gekrönt mit ew’gem Kranze glänzend einst und glorreich stand,
Ein geliebter heil’ger Lare dieser Stadt und diesem Land!
Die gebaut dieß Mal der Ehren, dünken mir dem Sünder gleich,
Der am Kirchenaltar opfert ein Votivbild, schmuck und reich,
Wähnend, daß nun desto freier lustig sünd’gen in den Tag
Und, was stets sein Heil’ger haßte, ungestraft er treiben mag!
Ach, sie haben arg gesündigt, diesen Heil’gen schwer verletzt,
Aus den Trümmern seines Domes ihm solch ärmlich Mal gesetzt! –
Herr, verzeiht, wenn ich nur Trübes rings erblickte immerdar!
Wer das Auge hat voll Thränen, ach, der sieht nicht immer klar! – –
Da erwacht’ ich aus dem Traume, und von Trümmern sah ich nichts,
Golden schien durch meine Fenster heitrer Gruß des Morgenlichts,
Kirchen und Paläste ragten hoch und fest im jungen Tag! –
Ei, warum nur noch die Thräne mir nicht aus dem Auge mag?