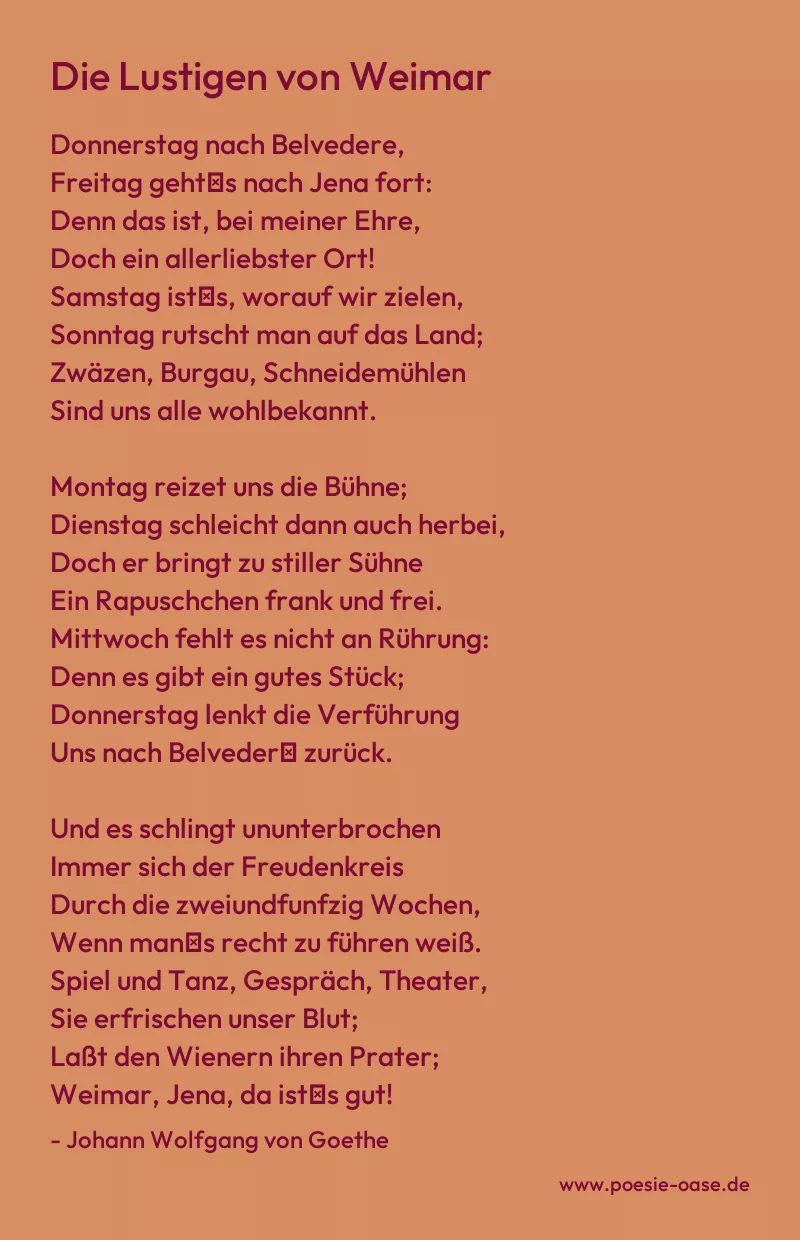Die Lustigen von Weimar
Donnerstag nach Belvedere,
Freitag geht′s nach Jena fort:
Denn das ist, bei meiner Ehre,
Doch ein allerliebster Ort!
Samstag ist′s, worauf wir zielen,
Sonntag rutscht man auf das Land;
Zwäzen, Burgau, Schneidemühlen
Sind uns alle wohlbekannt.
Montag reizet uns die Bühne;
Dienstag schleicht dann auch herbei,
Doch er bringt zu stiller Sühne
Ein Rapuschchen frank und frei.
Mittwoch fehlt es nicht an Rührung:
Denn es gibt ein gutes Stück;
Donnerstag lenkt die Verführung
Uns nach Belveder′ zurück.
Und es schlingt ununterbrochen
Immer sich der Freudenkreis
Durch die zweiundfunfzig Wochen,
Wenn man′s recht zu führen weiß.
Spiel und Tanz, Gespräch, Theater,
Sie erfrischen unser Blut;
Laßt den Wienern ihren Prater;
Weimar, Jena, da ist′s gut!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
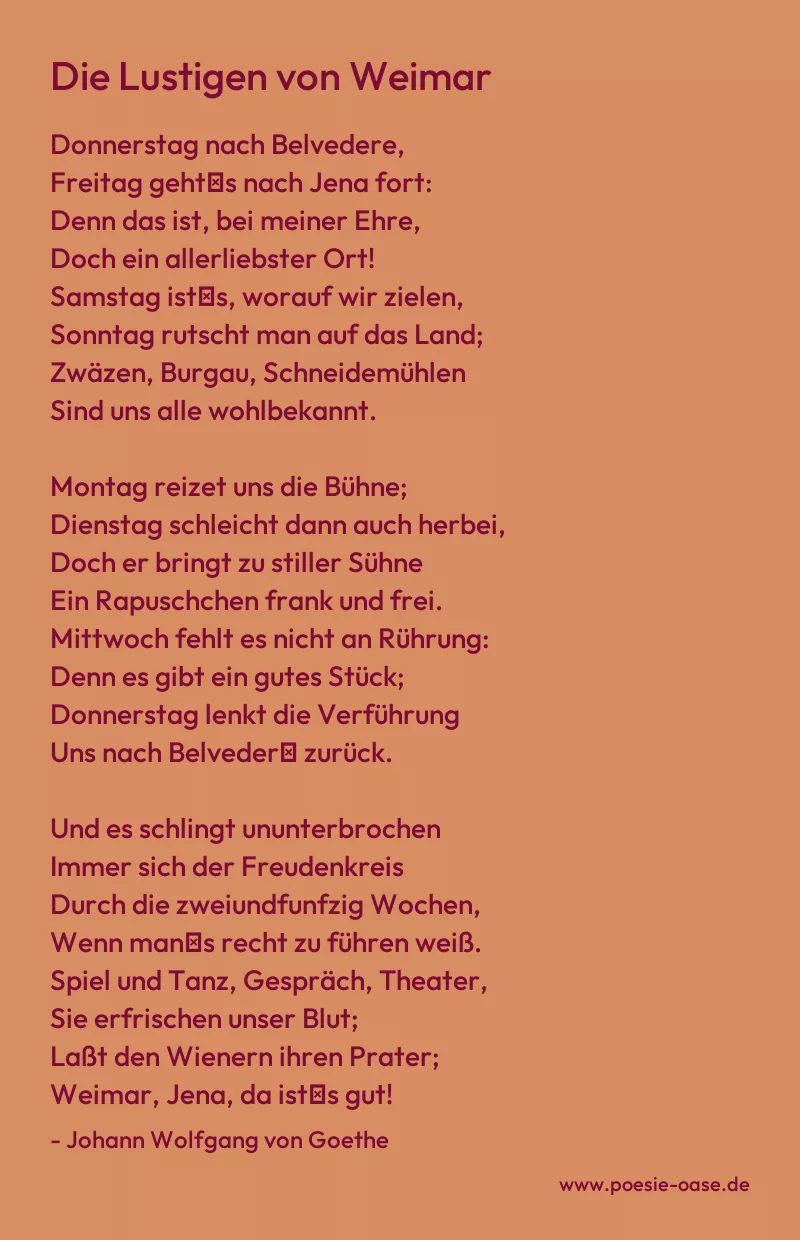
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Lustigen von Weimar“ von Johann Wolfgang von Goethe ist eine fröhliche, lebensbejahende Huldigung an das Vergnügen und die Freuden des Alltags, die im Weimar des Dichters zelebriert werden. Es beschreibt eine scheinbar endlose Kette von Vergnügungen und Ablenkungen, die durch die Woche zirkulieren und die Lebensfreude der Bewohner widerspiegeln. Die Wahl der konkreten Orte wie Belvedere, Jena, Burgau und Schneidemühlen deutet auf eine enge Verbundenheit mit der Region und den lokalen Gegebenheiten hin.
Goethe konstruiert die Abfolge der Freuden wie einen festlichen Kreislauf. Jedes Wochenende und jede Woche wird mit neuen Aktivitäten gefüllt, von Ausflügen ins Grüne über Theaterbesuche bis hin zu geselligen Abenden mit Spiel und Tanz. Die Erwähnung des „Rapuschchens“ (einem Essen) und der „Rührung“ (durch ein Theaterstück) unterstreicht die Vielfalt der Erlebnisse. Das Gedicht zeichnet ein Bild von unbeschwerter Lebenslust, in der die „zweiundfunfzig Wochen“ zu einem einzigen, andauernden Fest der Freude verschmelzen.
Die Sprache des Gedichts ist leicht und beschwingt, mit einfachen Reimen und einer direkten, unkomplizierten Wortwahl. Dieser Stil trägt zur Schaffung einer heiteren, positiven Atmosphäre bei. Das Gedicht atmet eine gewisse Lässigkeit und Unbekümmertheit, die die Lebensart in Weimar widerspiegelt. Die abschließenden Zeilen, in denen der Dichter die Vorliebe für Weimar, Jena und die Umgebung gegenüber dem Wiener Prater bekundet, verstärken den Lokalpatriotismus und die Wertschätzung für die eigenen Freuden.
Die Aussage des Gedichts ist eine Feier des Lebens, der Geselligkeit und der einfachen Freuden des Alltags. Es zeigt, wie eine durchgeplante Freizeitgestaltung, gefüllt mit Kultur, Spiel und Genuss, die Seele erfrischen und das Leben bereichern kann. Goethe, der selbst ein vielbeschäftigter Mann war, scheint hier eine Oase der Freude und Entspannung zu beschreiben, die gleichzeitig als Modell für ein erfülltes und genussreiches Leben dienen kann.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.