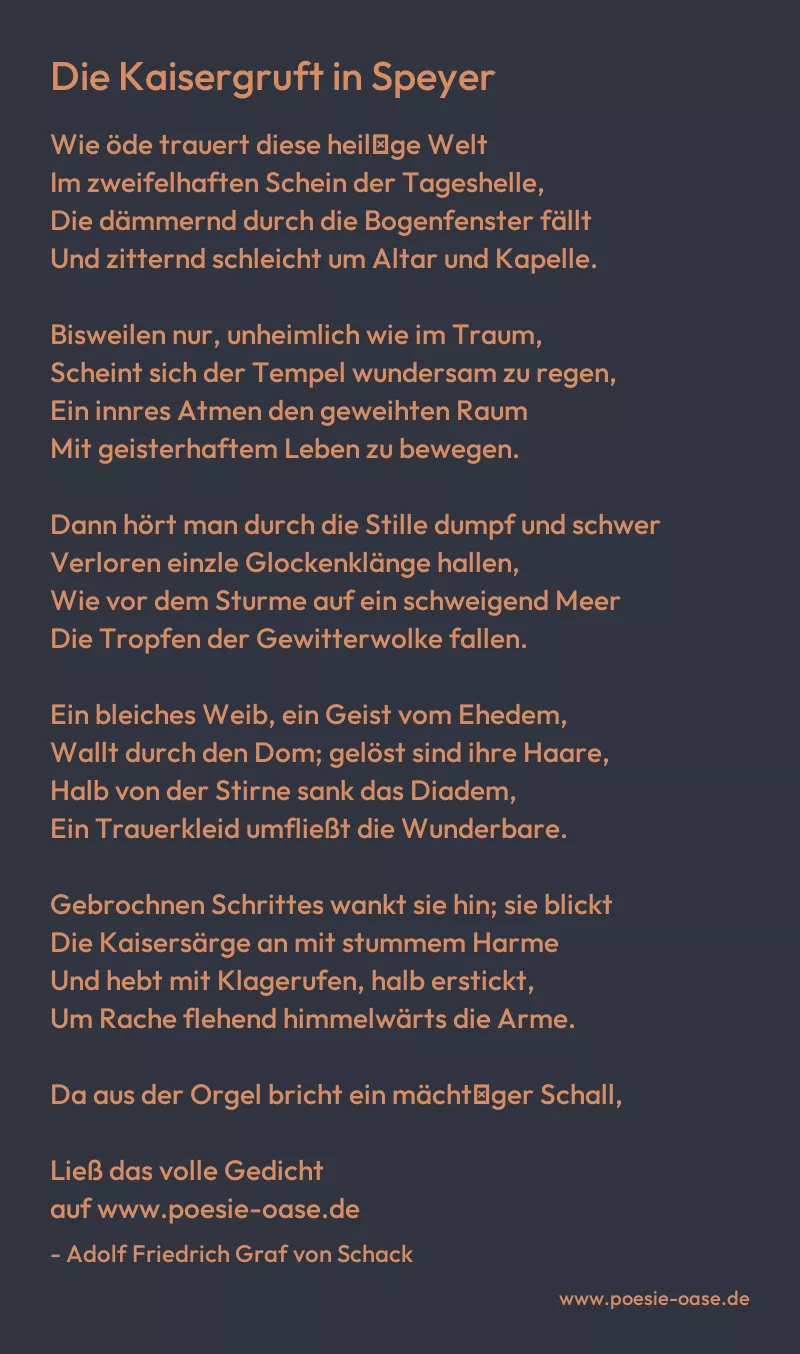Wie öde trauert diese heil′ge Welt
Im zweifelhaften Schein der Tageshelle,
Die dämmernd durch die Bogenfenster fällt
Und zitternd schleicht um Altar und Kapelle.
Bisweilen nur, unheimlich wie im Traum,
Scheint sich der Tempel wundersam zu regen,
Ein innres Atmen den geweihten Raum
Mit geisterhaftem Leben zu bewegen.
Dann hört man durch die Stille dumpf und schwer
Verloren einzle Glockenklänge hallen,
Wie vor dem Sturme auf ein schweigend Meer
Die Tropfen der Gewitterwolke fallen.
Ein bleiches Weib, ein Geist vom Ehedem,
Wallt durch den Dom; gelöst sind ihre Haare,
Halb von der Stirne sank das Diadem,
Ein Trauerkleid umfließt die Wunderbare.
Gebrochnen Schrittes wankt sie hin; sie blickt
Die Kaisersärge an mit stummem Harme
Und hebt mit Klagerufen, halb erstickt,
Um Rache flehend himmelwärts die Arme.
Da aus der Orgel bricht ein mächt′ger Schall,
Ein Sterbeseufzer, ihrer Brust entquollen,
Der bei der Säulengänge Wiederhall
Durch das Gewölbe schleicht mit dumpfem Rollen.
Und von dem Riesenklang erbebt das Licht
Der Lampen, die auf den Altären schimmern,
Daß geisterhaft, wohin es zitternd bricht,
Die Kreuze und die Leichensteine flimmern.
In dichtern Tropfen aus den Pfeifen träuft′s,
Und durch die Hallen schweben dunkle Schatten,
Und zwischendrein vernimmt man das Geseufz
Der Toten unter ihren Marmorplatten.
Bald wieder alles stille wie zuvor!
Rings Nacht und Schweigen in den öden Mauern;
Nur Kreuze, eingehüllt in schwarzen Flor,
Und Heil′ge, die in ihren Nischen trauern.