So nehm′ ich denn die Finsternis
Und balle sie zusammen
Und werfe sie, so weit ich kann,
Bis in die großen Flammen,
Die ich noch nicht gesehen habe
Und die doch da sind — irgendwo
Lichterloh…
Die grossen Flammen
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
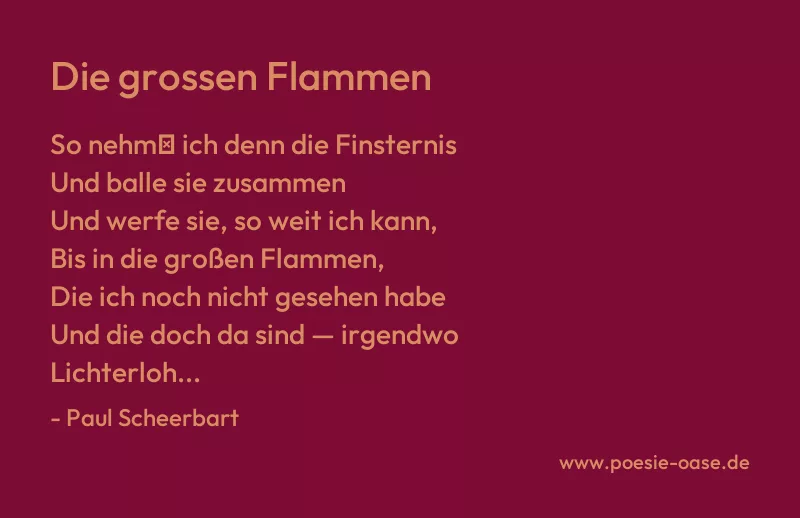
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die großen Flammen“ von Paul Scheerbart ist eine kurze, fast schon kindlich anmutende Auseinandersetzung mit dem Thema Dunkelheit und Licht. Es beginnt mit einer aktiven Geste: der Sprecher nimmt die Finsternis, ballt sie zusammen und wirft sie. Diese Handlung deutet auf einen Wunsch nach Überwindung der Dunkelheit hin, ein aktives Bemühen, das Negative, das Undefinierte, zu konfrontieren.
Die Bewegung des „Werfens“ lenkt die Dunkelheit auf ein Ziel, das in der Imagination existiert: die „großen Flammen“. Diese Flammen werden nicht konkret beschrieben, sondern bleiben ein Versprechen, eine Vorstellung von Helligkeit und möglicherweise auch von Zerstörung oder Transformation. Die Zeile „die ich noch nicht gesehen habe“ verstärkt den Eindruck des Ungesehenen, des Ersehnten und Unbekannten. Es ist ein Streben nach etwas, das über die momentane Realität hinausgeht.
Der letzte Vers „Und die doch da sind — irgendwo / Lichterloh…“ verleiht dem Gedicht eine paradoxe Note. Einerseits wird die Existenz der Flammen bestätigt, andererseits bleibt der genaue Ort unbestimmt. Das „irgendwo“ unterstreicht die Abstraktion und das Imaginäre. Das „Lichterloh“ ist eine eindringliche Beschreibung der Intensität des Lichts, die das Gedicht beschließt.
Insgesamt könnte man das Gedicht als eine Metapher für den menschlichen Wunsch nach Erkenntnis, nach dem Überwinden von Ungewissheit und nach dem Erreichen von etwas Höherem interpretieren. Die Dunkelheit steht für das Unwissen, das Unverständliche, während die Flammen für das Wissen, die Klarheit oder vielleicht auch für die Gefahr des Übermaßes stehen. Scheerbarts Gedicht ist eine Aufforderung, sich der Dunkelheit zu stellen, um das Licht zu finden, auch wenn dieses noch unbekannt ist.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
