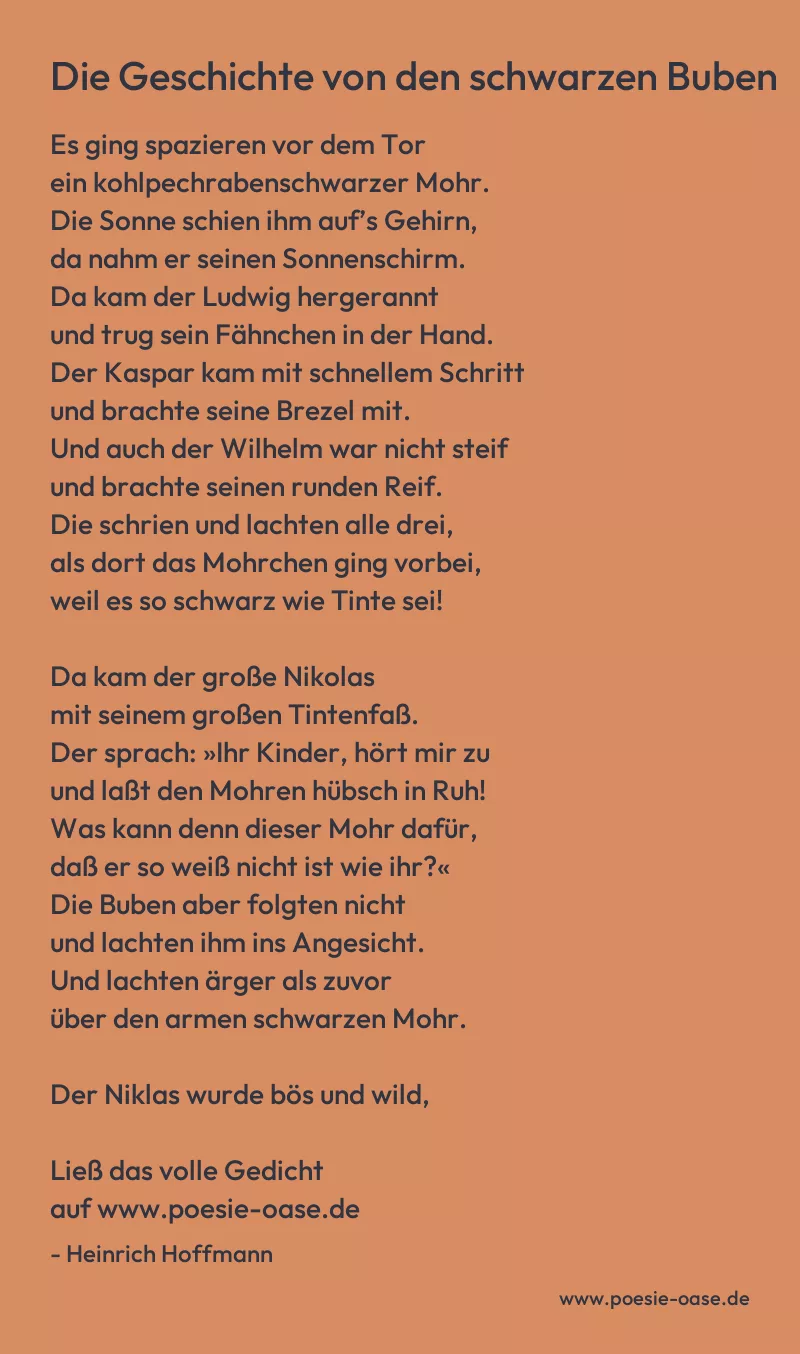Die Geschichte von den schwarzen Buben
Es ging spazieren vor dem Tor
ein kohlpechrabenschwarzer Mohr.
Die Sonne schien ihm auf’s Gehirn,
da nahm er seinen Sonnenschirm.
Da kam der Ludwig hergerannt
und trug sein Fähnchen in der Hand.
Der Kaspar kam mit schnellem Schritt
und brachte seine Brezel mit.
Und auch der Wilhelm war nicht steif
und brachte seinen runden Reif.
Die schrien und lachten alle drei,
als dort das Mohrchen ging vorbei,
weil es so schwarz wie Tinte sei!
Da kam der große Nikolas
mit seinem großen Tintenfaß.
Der sprach: »Ihr Kinder, hört mir zu
und laßt den Mohren hübsch in Ruh!
Was kann denn dieser Mohr dafür,
daß er so weiß nicht ist wie ihr?«
Die Buben aber folgten nicht
und lachten ihm ins Angesicht.
Und lachten ärger als zuvor
über den armen schwarzen Mohr.
Der Niklas wurde bös und wild,
du siehst es hier auf diesem Bild!
Er packte gleich die Buben fest,
beim Arm, beim Kopf, bei Rock und West,
den Wilhelm und den Ludewig,
den Kaspar auch, der wehrte sich.
Er tunkt sie in die Tinte tief,
wie auch der Kaspar »Feuer« rief.
Bis übern Kopf ins Tintenfaß
tunkt sie der große Nikolas.
Du siehst sie hier, wie schwarz sie sind,
viel schwärzer als das Mohrenkind.
Der Mohr voraus im Sonnenschein,
die Tintenbuben hinterdrein;
und hätten sie nicht so gelacht,
hätt Niklas sie nicht schwarz gemacht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
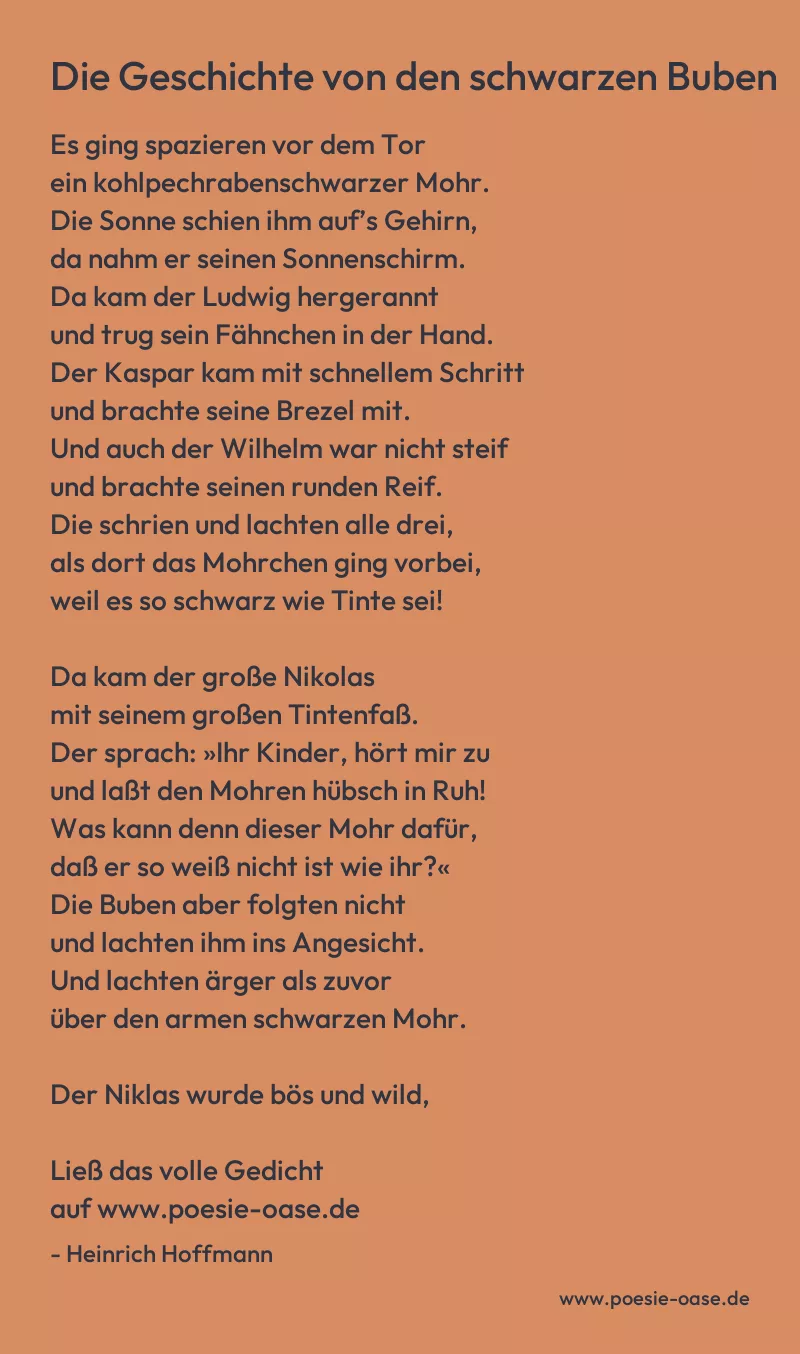
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Die Geschichte von den schwarzen Buben“ von Heinrich Hoffmann ist eine humorvolle und moralisierende Geschichte über Rassismus und die Folgen von Ausgrenzung und Hänselei. Das Gedicht beginnt mit der Beschreibung eines schwarzen Mohren, der spazieren geht, und drei Kindern, die ihn aufgrund seiner Hautfarbe auslachen. Hoffmann wählt einen einfachen, kindgerechten Stil, um die Geschichte zu erzählen, mit Reimen und einem klaren Erzählfluss, der das Verständnis erleichtert.
Im Kern des Gedichts steht die Botschaft der Toleranz und des Respekts gegenüber Andersartigkeit. Die Kinder, repräsentiert durch Ludwig, Kaspar und Wilhelm, verkörpern die Vorurteile und das Unverständnis gegenüber dem Mohren. Ihre Reaktion auf den Mohren – Lachen und Spott – zeigt eine fehlende Akzeptanz und ein mangelndes Bewusstsein für die Gefühle des anderen. Dies wird durch die Reaktion des Nikolaus konterkariert, der als moralische Instanz fungiert und die Kinder zur Ruhe mahnt.
Die Wendung in der Geschichte, in der Nikolaus die Kinder in Tinte tunkt, ist eine drastische, aber effektive Methode, um die Ungerechtigkeit des Verhaltens der Kinder aufzuzeigen. Indem die Kinder nun selbst schwarz werden, erfahren sie am eigenen Leib, wie es ist, aufgrund äußerlicher Merkmale diskriminiert zu werden. Diese Aktion kann als eine Art Strafe, aber auch als eine Form der „Gerechtigkeit“ interpretiert werden, die die Kinder dazu zwingt, ihre eigenen Vorurteile zu überdenken. Die Metapher der Tinte steht hier für die dunkle, verletzende Natur von Vorurteilen.
Das Gedicht ist somit eine klare Warnung vor Rassismus und eine Ermutigung zur Akzeptanz von Andersartigkeit. Die Pointe am Ende, dass die Kinder nur aufgrund ihres Lachens und ihrer Verachtung „schwarz gemacht“ wurden, unterstreicht die Konsequenzen von Intoleranz und die Bedeutung von Empathie. Hoffmann benutzt eine spielerische, kindliche Erzählweise, um eine ernste Botschaft zu vermitteln, die auch heute noch ihre Relevanz behält.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.