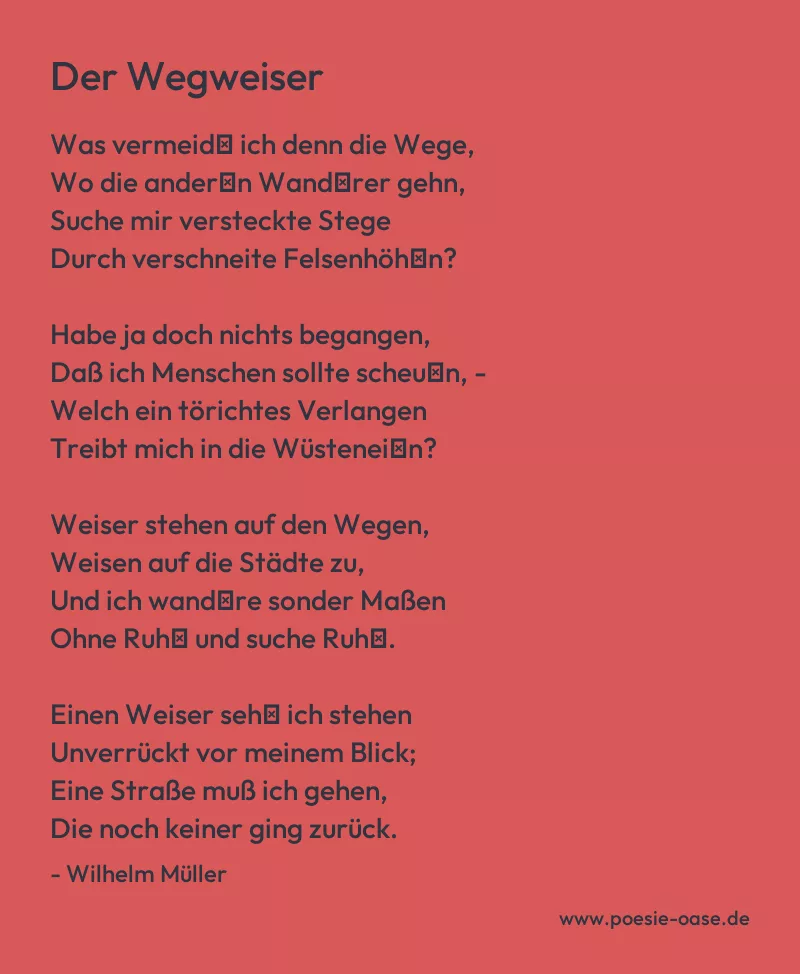Der Wegweiser
Was vermeid′ ich denn die Wege,
Wo die ander′n Wand′rer gehn,
Suche mir versteckte Stege
Durch verschneite Felsenhöh′n?
Habe ja doch nichts begangen,
Daß ich Menschen sollte scheu′n, –
Welch ein törichtes Verlangen
Treibt mich in die Wüstenei′n?
Weiser stehen auf den Wegen,
Weisen auf die Städte zu,
Und ich wand′re sonder Maßen
Ohne Ruh′ und suche Ruh′.
Einen Weiser seh′ ich stehen
Unverrückt vor meinem Blick;
Eine Straße muß ich gehen,
Die noch keiner ging zurück.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
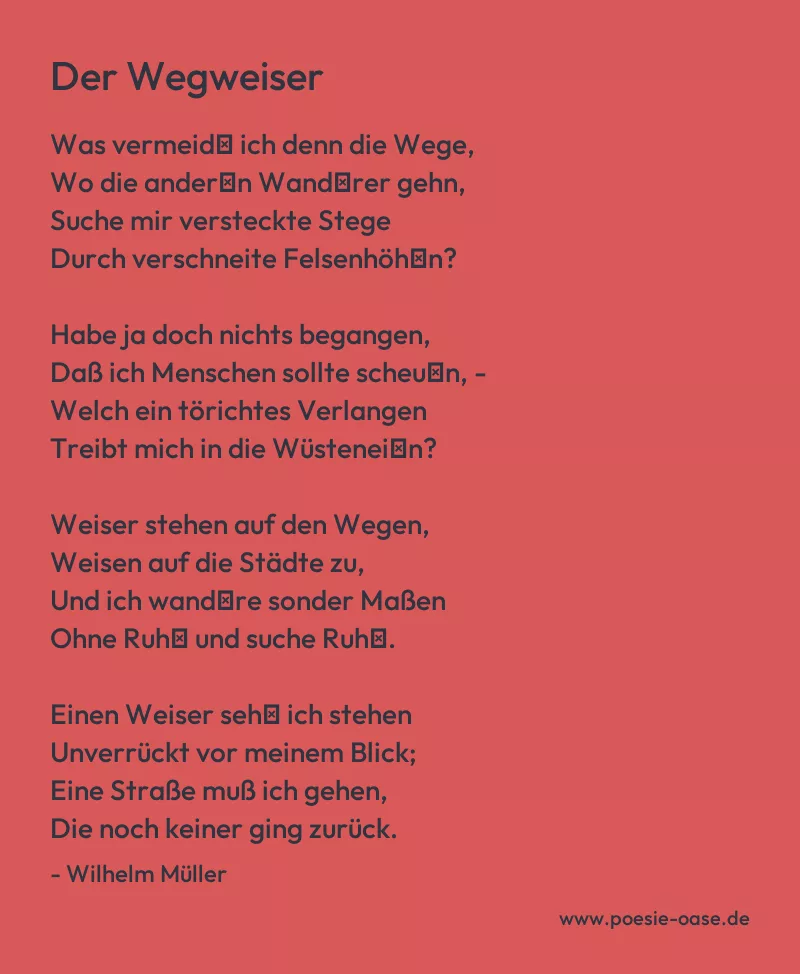
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Wegweiser“ von Wilhelm Müller ist eine melancholische Betrachtung über Einsamkeit, das Verlassen der Gemeinschaft und die Suche nach einem unausweichlichen Schicksal. Der Sprecher des Gedichts stellt sich selbst und sein Verhalten in Frage, indem er die offensichtlichen Wege vermeidet und stattdessen abgelegene, beschwerliche Pfade wählt. Die Eröffnung des Gedichts deutet bereits auf eine innere Zerrissenheit hin, eine Suche nach dem Warum und Weshalb, die den Leser unmittelbar in die Gefühlswelt des Wanderers eintauchen lässt.
Im zweiten Abschnitt intensiviert sich diese Selbstbefragung. Der Sprecher räumt ein, dass er keinen triftigen Grund hat, Menschen zu meiden, und fragt sich, was ihn in die „Wüstenei’n“ treibt. Dies deutet auf ein tiefer liegendes, unbewusstes Motiv hin, das den Wanderer von den üblichen Pfaden ablenkt. Die „Wüstenei’n“ symbolisieren dabei eine Leere, eine Isolation, die sowohl physisch als auch emotional zu verstehen ist. Die Frage nach dem „törichten Verlangen“ impliziert eine gewisse Erkenntnis, dass das Verhalten des Sprechers irrational und möglicherweise selbstzerstörerisch ist.
Die dritte Strophe führt einen Kontrast ein: Während andere den Wegweisern folgen und somit in die Städte gelangen, irrt der Sprecher ruhelos umher und sucht gleichzeitig Ruhe. Dies unterstreicht die Paradoxie seines Zustands, das Hin- und Hergerissen-Sein zwischen dem Wunsch nach Gemeinschaft und dem Drang zur Isolation. Die Weiser, die auf Städte verweisen, repräsentieren die Möglichkeit, einen vorgegebenen Weg zu gehen, das gesellschaftliche Leben und die Sicherheit, die mit einer festen Bestimmung einhergeht. Der Sprecher jedoch wählt den entgegengesetzten Weg.
Der abschließende Abschnitt des Gedichts führt zur Erkenntnis: Der Sprecher sieht einen Wegweiser, der auf eine Straße deutet, die noch niemand zurückgegangen ist. Dies impliziert, dass der Sprecher einem unvermeidlichen Schicksal entgegengeht, einer Reise ohne Rückkehr. Der „Weiser“ in der letzten Strophe ist nicht mehr ein Wegweiser im herkömmlichen Sinne, sondern ein Symbol für die unausweichliche Bestimmung, die den Wanderer zu einer einsamen, ungewissen Zukunft treibt. Die letzte Zeile lässt offen, ob dieser Weg ein Verlust oder ein tieferes Verständnis von sich selbst bringt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.