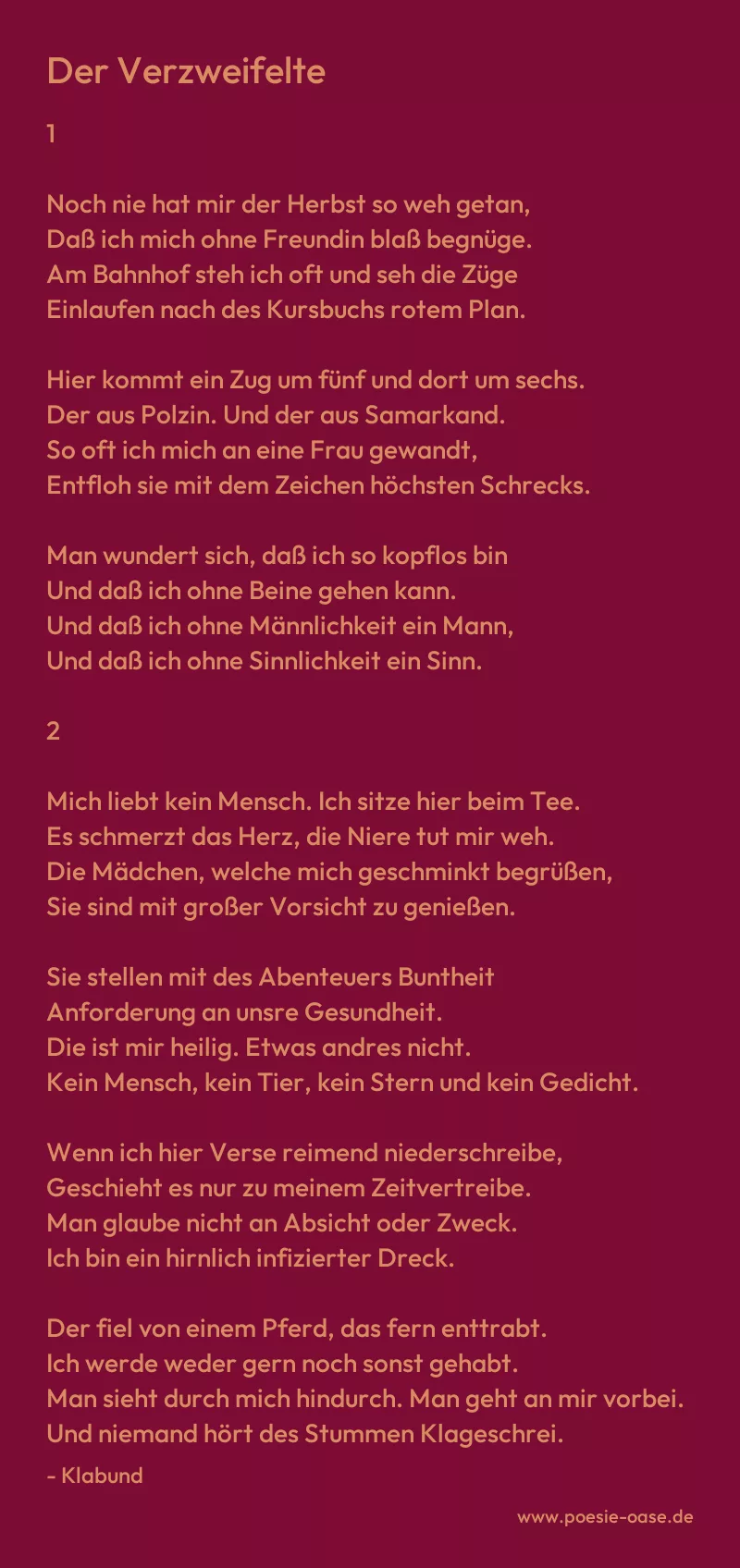Der Verzweifelte
1
Noch nie hat mir der Herbst so weh getan,
Daß ich mich ohne Freundin blaß begnüge.
Am Bahnhof steh ich oft und seh die Züge
Einlaufen nach des Kursbuchs rotem Plan.
Hier kommt ein Zug um fünf und dort um sechs.
Der aus Polzin. Und der aus Samarkand.
So oft ich mich an eine Frau gewandt,
Entfloh sie mit dem Zeichen höchsten Schrecks.
Man wundert sich, daß ich so kopflos bin
Und daß ich ohne Beine gehen kann.
Und daß ich ohne Männlichkeit ein Mann,
Und daß ich ohne Sinnlichkeit ein Sinn.
2
Mich liebt kein Mensch. Ich sitze hier beim Tee.
Es schmerzt das Herz, die Niere tut mir weh.
Die Mädchen, welche mich geschminkt begrüßen,
Sie sind mit großer Vorsicht zu genießen.
Sie stellen mit des Abenteuers Buntheit
Anforderung an unsre Gesundheit.
Die ist mir heilig. Etwas andres nicht.
Kein Mensch, kein Tier, kein Stern und kein Gedicht.
Wenn ich hier Verse reimend niederschreibe,
Geschieht es nur zu meinem Zeitvertreibe.
Man glaube nicht an Absicht oder Zweck.
Ich bin ein hirnlich infizierter Dreck.
Der fiel von einem Pferd, das fern enttrabt.
Ich werde weder gern noch sonst gehabt.
Man sieht durch mich hindurch. Man geht an mir vorbei.
Und niemand hört des Stummen Klageschrei.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
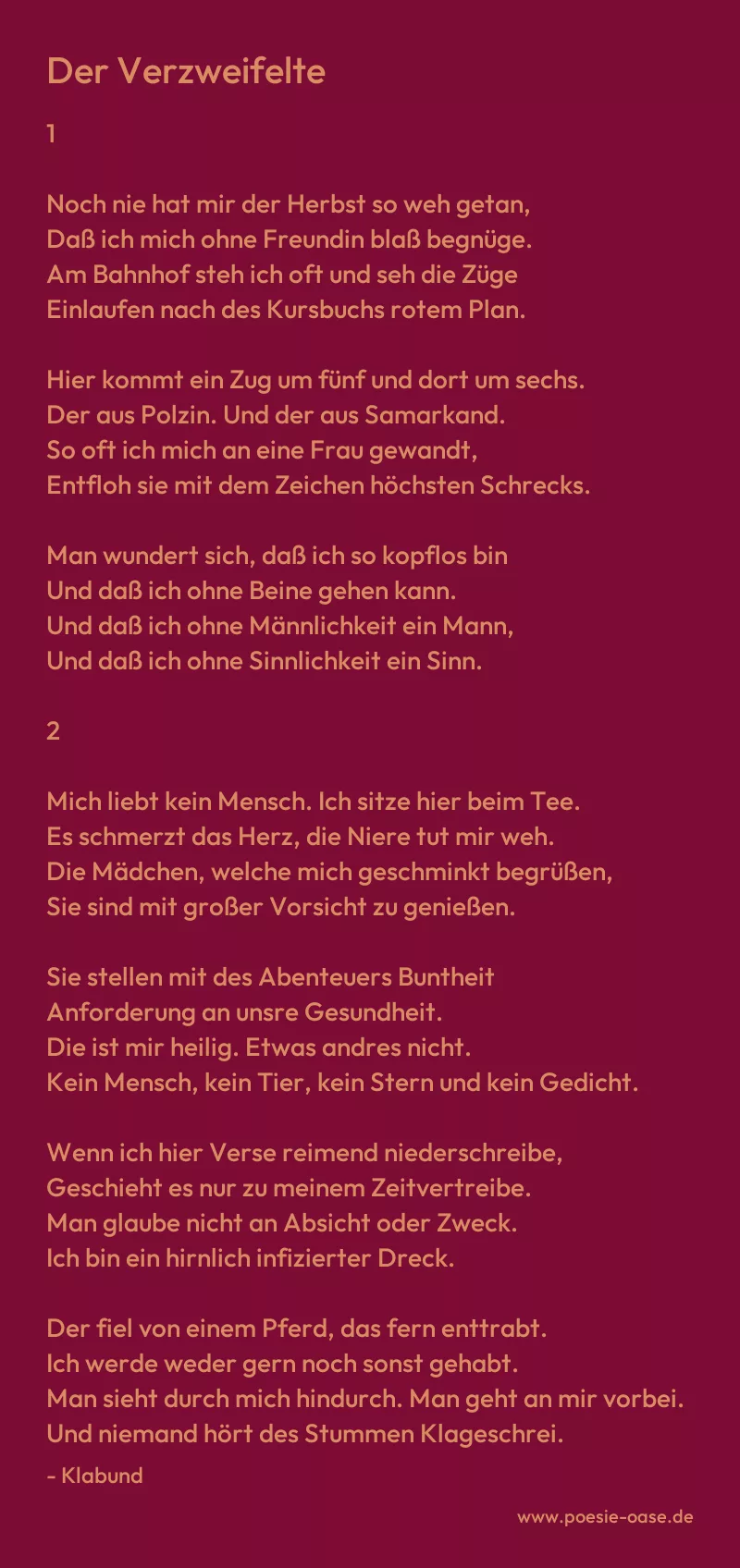
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Verzweifelte“ von Klabund ist ein ergreifendes Selbstporträt eines Mannes, der von tiefgreifender Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit geplagt wird. Der Herbst, traditionell eine Zeit des Wandels und der Melancholie, verstärkt hier die ohnehin schon vorhandene Traurigkeit des lyrischen Ichs. Es ist ein Gedicht über die Unfähigkeit zur Liebe, die Enttäuschung über die oberflächlichen Beziehungen und die bittere Erkenntnis der eigenen Bedeutungslosigkeit.
Der erste Teil des Gedichts zeichnet ein Bild von Stagnation und Sehnsucht. Der Mann steht am Bahnhof, beobachtet die Züge, die als Metaphern für unerreichbare Ziele und verpasste Chancen dienen. Die Züge aus fernen Orten wie Polzin und Samarkand symbolisieren die Sehnsucht nach etwas anderem, nach Flucht aus dem eigenen Elend. Die Erfahrung der Ablehnung, die er bei Frauen erfährt, wird als Ursache für seine Verzweiflung dargestellt. Die Frage nach seinem Wesen – „ohne Beine gehen“, „ohne Männlichkeit ein Mann“, „ohne Sinnlichkeit ein Sinn“ – verdeutlicht ein tiefes Gefühl der Selbstentfremdung und der Sinnlosigkeit. Er fühlt sich seinem Dasein entfremdet, es fehlt ihm die Basis für ein erfülltes Leben.
Der zweite Teil des Gedichts vertieft die Thematik der Isolation und der Desillusionierung. Die Beschreibung der Mädchen, die er trifft, als „mit großer Vorsicht zu genießen“ deutet auf eine Abneigung gegen oberflächliche Beziehungen und die Vorsicht vor den vermeintlichen Gefahren dieser. Er findet keinen Trost in menschlichen Beziehungen, in der Natur oder in der Kunst. Die Verse, die er schreibt, sind nur ein Zeitvertreib, ohne Absicht oder Zweck, und somit die Folge seines inneren Zustandes. Die drastische Selbstbezeichnung als „hirnlich infizierter Dreck“ offenbart ein tiefes Selbstverachtung und die Überzeugung, dass er für die Welt unsichtbar ist.
Das Gedicht ist in einer klaren, direkten Sprache geschrieben, die die Gefühlslage des Sprechers unmittelbar vermittelt. Der Gebrauch von Reimen und Rhythmus erzeugt einen Sog, der den Leser in die düstere Welt des lyrischen Ichs hineinzieht. Der Schmerz und die Verzweiflung werden durch die schonungslose Offenheit der Aussagen und die metaphorische Gestaltung des Inhalts umso intensiver. Die abschließenden Zeilen, in denen er von der Welt ignoriert wird, unterstreichen die radikale Einsamkeit und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das das Gedicht durchzieht. Es ist eine schonungslose Analyse der inneren Leere und des Scheiterns.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.