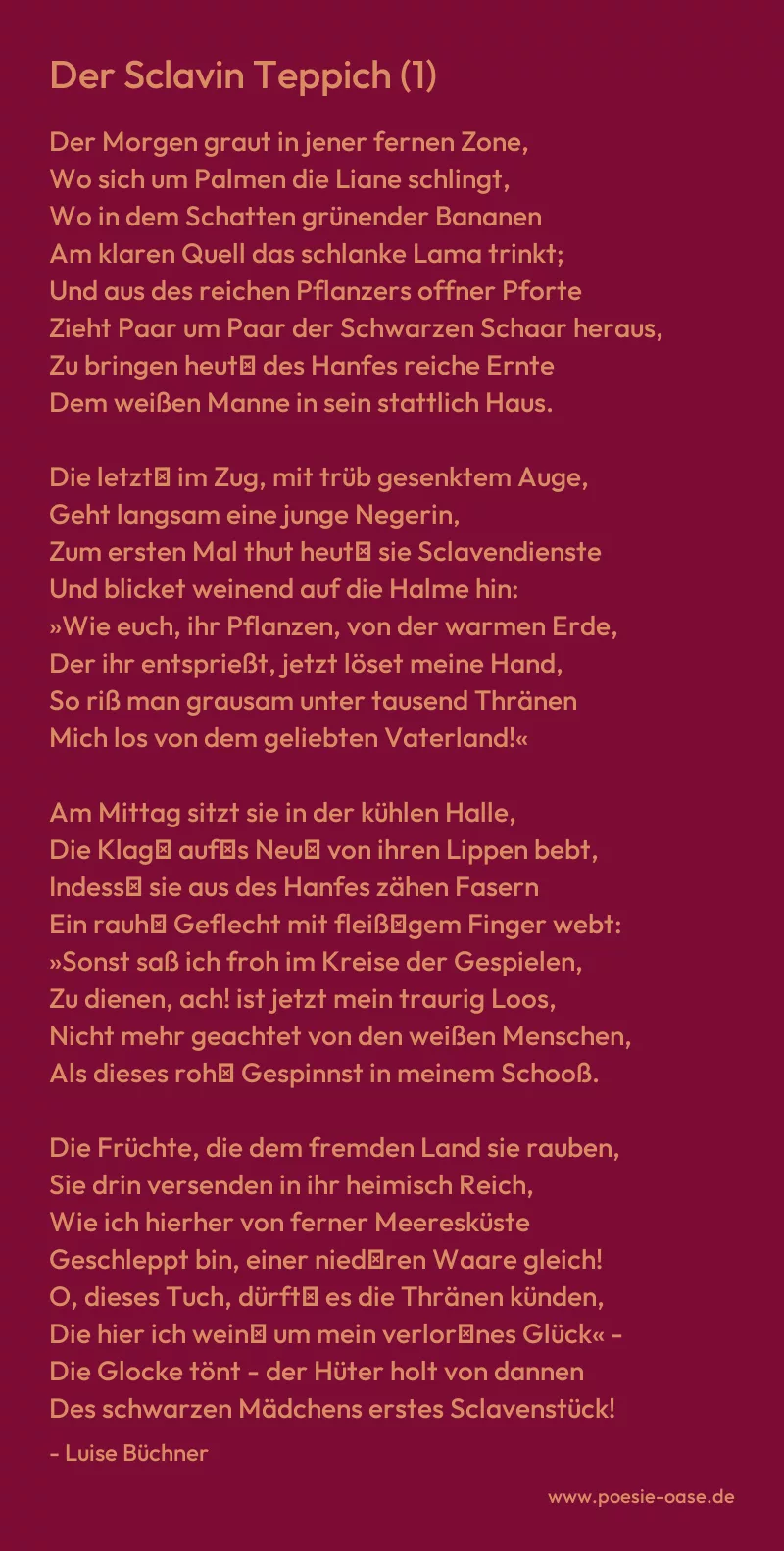Der Sclavin Teppich (1)
Der Morgen graut in jener fernen Zone,
Wo sich um Palmen die Liane schlingt,
Wo in dem Schatten grünender Bananen
Am klaren Quell das schlanke Lama trinkt;
Und aus des reichen Pflanzers offner Pforte
Zieht Paar um Paar der Schwarzen Schaar heraus,
Zu bringen heut′ des Hanfes reiche Ernte
Dem weißen Manne in sein stattlich Haus.
Die letzt′ im Zug, mit trüb gesenktem Auge,
Geht langsam eine junge Negerin,
Zum ersten Mal thut heut′ sie Sclavendienste
Und blicket weinend auf die Halme hin:
»Wie euch, ihr Pflanzen, von der warmen Erde,
Der ihr entsprießt, jetzt löset meine Hand,
So riß man grausam unter tausend Thränen
Mich los von dem geliebten Vaterland!«
Am Mittag sitzt sie in der kühlen Halle,
Die Klag′ auf′s Neu′ von ihren Lippen bebt,
Indess′ sie aus des Hanfes zähen Fasern
Ein rauh′ Geflecht mit fleiß′gem Finger webt:
»Sonst saß ich froh im Kreise der Gespielen,
Zu dienen, ach! ist jetzt mein traurig Loos,
Nicht mehr geachtet von den weißen Menschen,
Als dieses roh′ Gespinnst in meinem Schooß.
Die Früchte, die dem fremden Land sie rauben,
Sie drin versenden in ihr heimisch Reich,
Wie ich hierher von ferner Meeresküste
Geschleppt bin, einer nied′ren Waare gleich!
O, dieses Tuch, dürft′ es die Thränen künden,
Die hier ich wein′ um mein verlor′nes Glück« –
Die Glocke tönt – der Hüter holt von dannen
Des schwarzen Mädchens erstes Sclavenstück!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
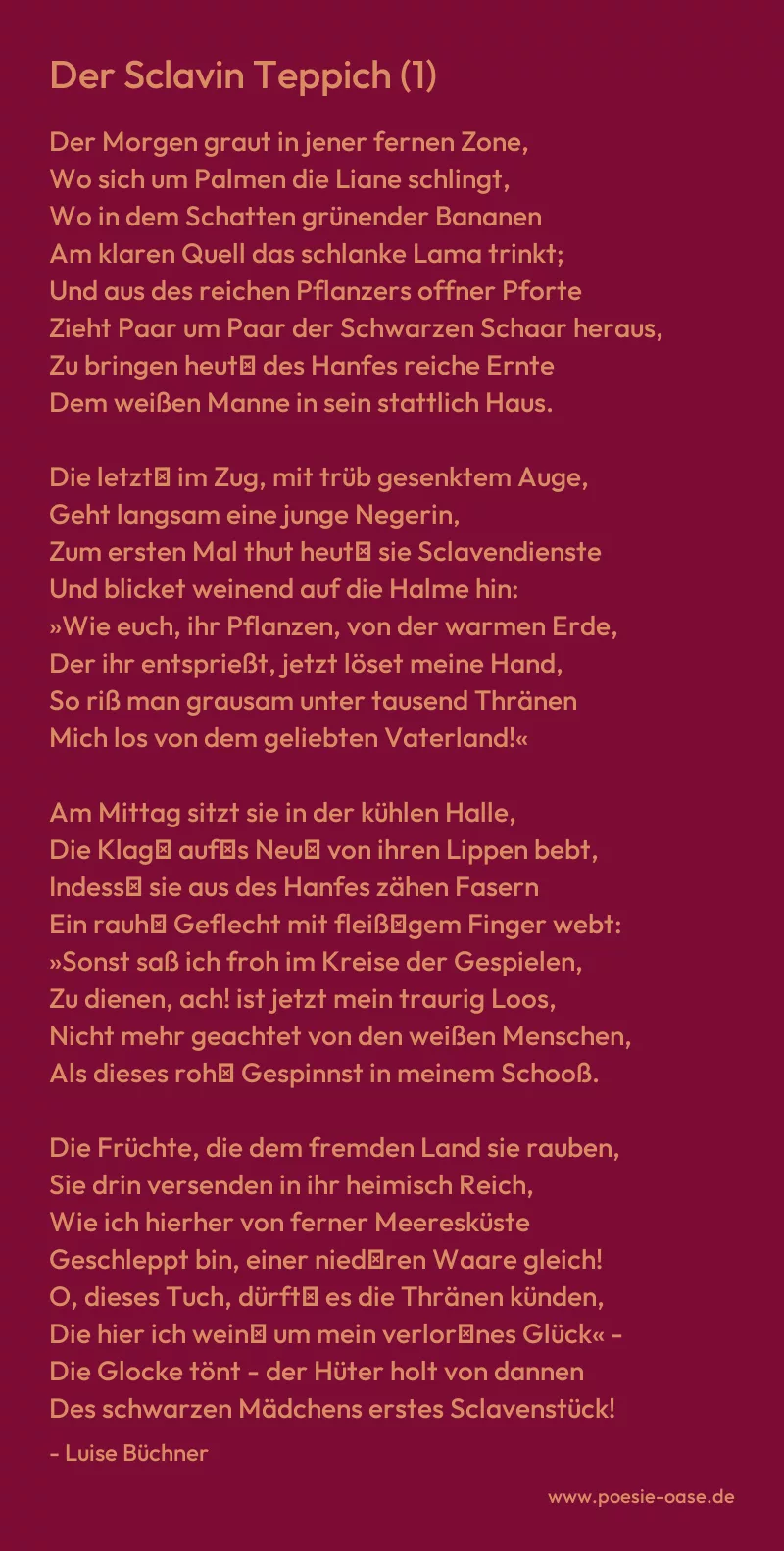
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Sclavin Teppich (1)“ von Luise Büchner ist eine ergreifende Reflexion über die Erfahrungen einer jungen Sklavin, die im Kontext der Kolonialisierung und der Sklaverei in einer fremden Welt zur Arbeit gezwungen wird. Das Gedicht zeichnet ein Bild von Entwurzelung, Verlust und Ungerechtigkeit, indem es die Emotionen und das Leid der Sklavin in den Mittelpunkt stellt. Es thematisiert die Zerstörung der individuellen Freiheit, die durch die brutale Praxis der Sklaverei verursacht wurde.
Das Gedicht beginnt mit einer Beschreibung der exotischen Umgebung, in der die Sklavin lebt und arbeitet, einer fernen Zone mit Palmen, Lianen und Bananen. Dieser Auftakt dient dazu, den Kontrast zwischen der ursprünglichen Heimat der Sklavin und ihrer aktuellen Situation zu verstärken. Die Metapher des „grauenden Morgens“ in der Ferne deutet auf das Gefühl der Hoffnungslosigkeit und des Verlusts, das die Sklavin empfindet. Die Erwähnung der „Schwarzen Schaar“ und des „weißen Mannes“ veranschaulicht die soziale Ungleichheit und die Ausbeutung, der die Sklavin ausgesetzt ist. Die Beschreibung des „stattlichen Hauses“ des weißen Mannes unterstreicht den wirtschaftlichen Vorteil, den die Sklaverei für die Kolonialherren darstellte.
Der zweite Abschnitt des Gedichts vertieft die persönliche Tragödie der Sklavin. Sie wird als „junge Negerin“ beschrieben, die zum ersten Mal Sklavendienste verrichten muss. Ihr „trüb gesenktes Auge“ und ihre „weinenden“ Blicke auf die Halme des Hanfs, den sie ernten muss, offenbaren ihr tiefes Leid und ihre Sehnsucht nach ihrer verlorenen Heimat. Der Vergleich ihrer Situation mit der Trennung der Pflanzen von der Erde verdeutlicht das Ausmaß ihres Verlustes und die Brutalität, mit der sie von ihrem „geliebten Vaterland“ getrennt wurde. Diese Zeilen sind von großer emotionaler Tiefe und drücken das Gefühl der Entwurzelung und des Verlusts aus, das die Sklavin erlebt.
Im dritten Abschnitt des Gedichts wird die Sklavin bei ihrer Arbeit am „rauen Geflecht“ gezeigt, einem Teppich, den sie aus dem Hanf weben muss. Während sie arbeitet, fließen ihre Tränen, und ihre Klagelieder werden erneut hörbar. Sie erinnert sich an ihre „frohe“ Zeit in ihrer Heimat und vergleicht ihr jetziges Los mit dem der „rauen“ Fasern, die sie verarbeiten muss. Die Zeilen drücken ihr Gefühl der Wertlosigkeit und der Erniedrigung aus, die sie durch die Sklaverei erfährt. Der Vergleich mit einer „nied’ren Waare“ unterstreicht die Entmenschlichung, der die Sklavin ausgesetzt ist. Das Gedicht endet mit dem Klingeln der Glocke, die das Ende der Arbeitszeit ankündigt, und dem Abtransport ihres ersten „Sklavenstücks“. Dies unterstreicht die Sinnlosigkeit und die Zirkularität ihrer Arbeit und ihres Leidens.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.