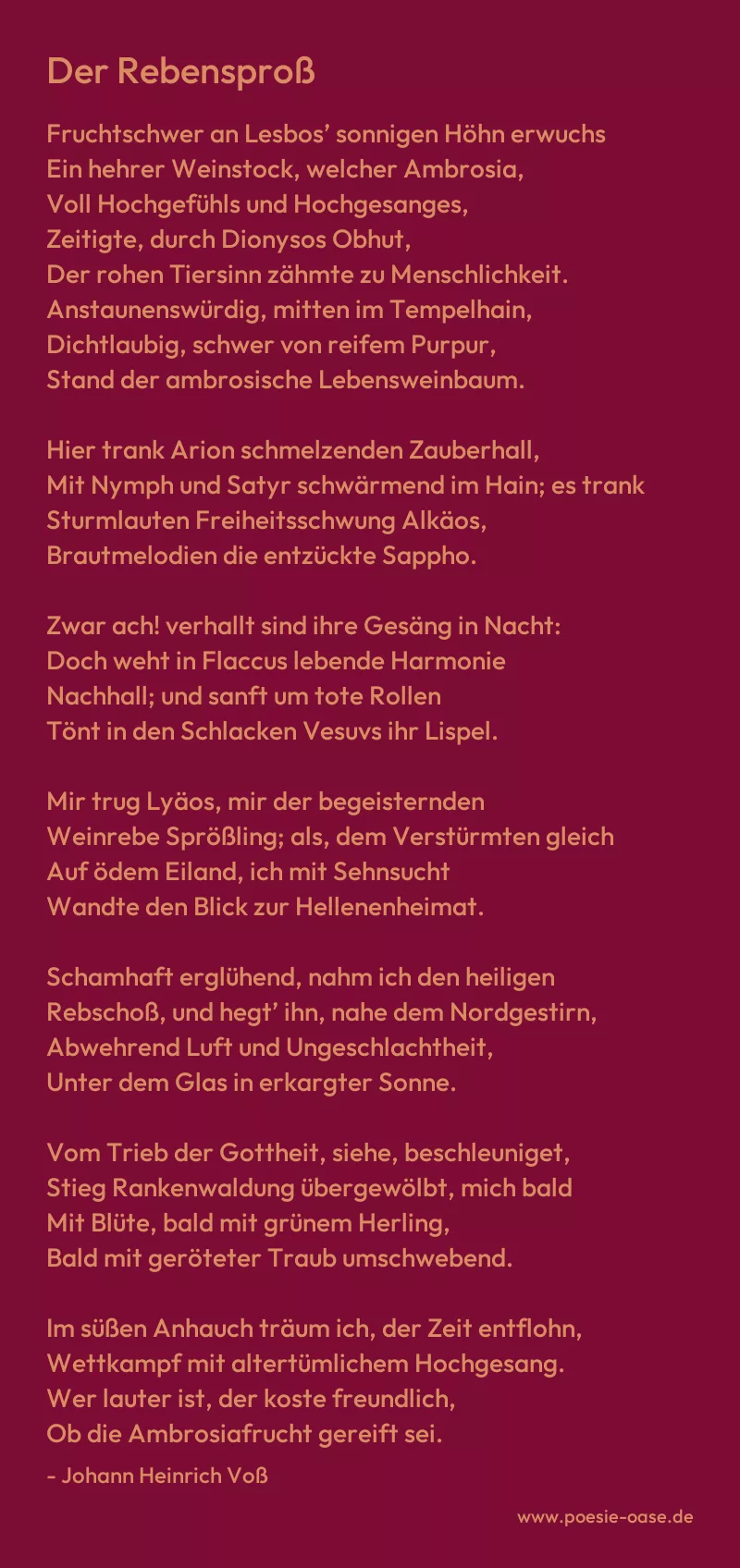Fruchtschwer an Lesbos’ sonnigen Höhn erwuchs
Ein hehrer Weinstock, welcher Ambrosia,
Voll Hochgefühls und Hochgesanges,
Zeitigte, durch Dionysos Obhut,
Der rohen Tiersinn zähmte zu Menschlichkeit.
Anstaunenswürdig, mitten im Tempelhain,
Dichtlaubig, schwer von reifem Purpur,
Stand der ambrosische Lebensweinbaum.
Hier trank Arion schmelzenden Zauberhall,
Mit Nymph und Satyr schwärmend im Hain; es trank
Sturmlauten Freiheitsschwung Alkäos,
Brautmelodien die entzückte Sappho.
Zwar ach! verhallt sind ihre Gesäng in Nacht:
Doch weht in Flaccus lebende Harmonie
Nachhall; und sanft um tote Rollen
Tönt in den Schlacken Vesuvs ihr Lispel.
Mir trug Lyäos, mir der begeisternden
Weinrebe Sprößling; als, dem Verstürmten gleich
Auf ödem Eiland, ich mit Sehnsucht
Wandte den Blick zur Hellenenheimat.
Schamhaft erglühend, nahm ich den heiligen
Rebschoß, und hegt’ ihn, nahe dem Nordgestirn,
Abwehrend Luft und Ungeschlachtheit,
Unter dem Glas in erkargter Sonne.
Vom Trieb der Gottheit, siehe, beschleuniget,
Stieg Rankenwaldung übergewölbt, mich bald
Mit Blüte, bald mit grünem Herling,
Bald mit geröteter Traub umschwebend.
Im süßen Anhauch träum ich, der Zeit entflohn,
Wettkampf mit altertümlichem Hochgesang.
Wer lauter ist, der koste freundlich,
Ob die Ambrosiafrucht gereift sei.