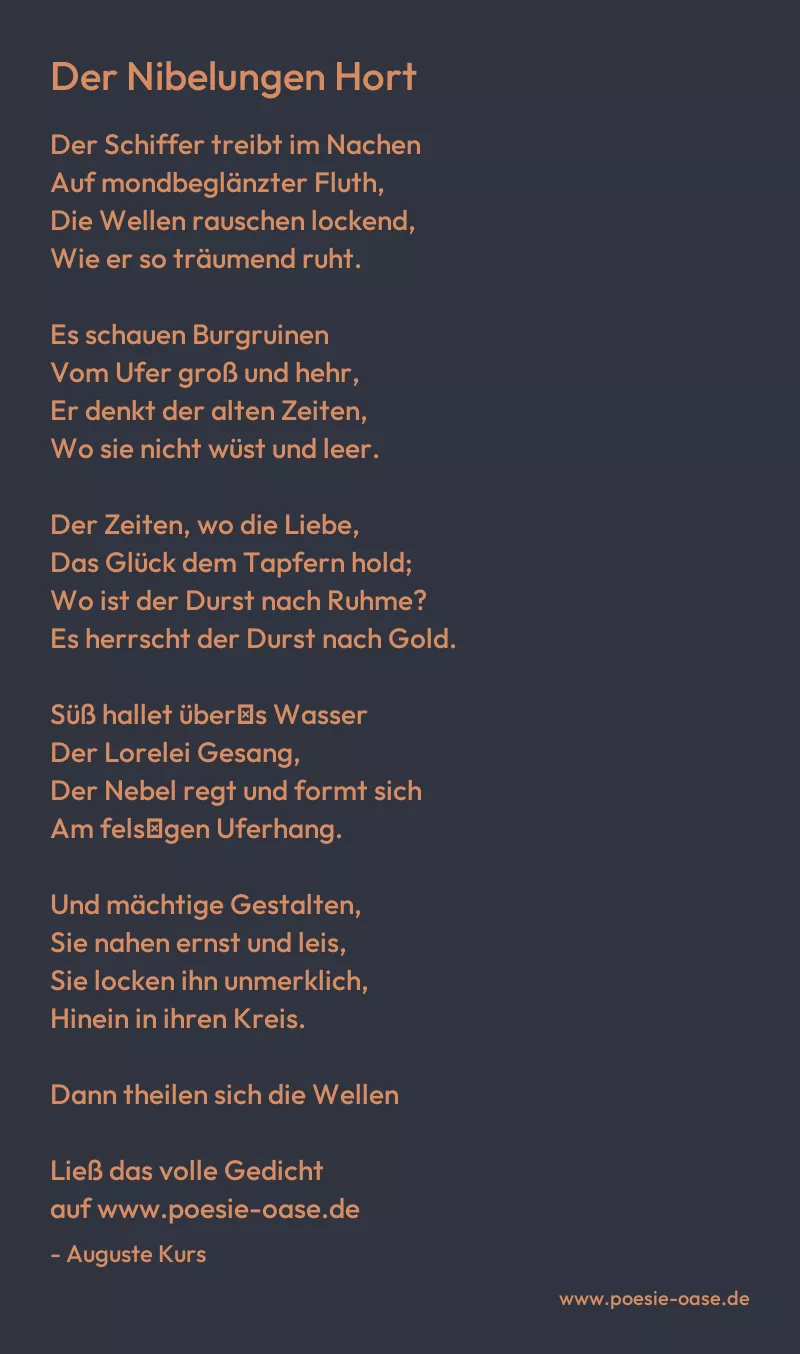Der Schiffer treibt im Nachen
Auf mondbeglänzter Fluth,
Die Wellen rauschen lockend,
Wie er so träumend ruht.
Es schauen Burgruinen
Vom Ufer groß und hehr,
Er denkt der alten Zeiten,
Wo sie nicht wüst und leer.
Der Zeiten, wo die Liebe,
Das Glück dem Tapfern hold;
Wo ist der Durst nach Ruhme?
Es herrscht der Durst nach Gold.
Süß hallet über′s Wasser
Der Lorelei Gesang,
Der Nebel regt und formt sich
Am fels′gen Uferhang.
Und mächtige Gestalten,
Sie nahen ernst und leis,
Sie locken ihn unmerklich,
Hinein in ihren Kreis.
Dann theilen sich die Wellen
Und drängen weit zurück,
Es spähet tief hinunter
Sein ahnungsvoller Blick.
Da funkeln Kron′ und Becher
Und Spangen sonder Zahl,
Es leuchtet rings die Tiefe
Von der Juwelen Strahl.
Und nun erkennt er Alles,
Die Nächt′gen, wie den Ort,
Das sind die Nibelungen,
Das ist ihr reicher Hort.
Viel bleiche Hüter sitzen
Dort unten bei der Pracht,
»O wer das Wort nun wüßte,
Das starr die Wellen macht!«
Und wer die Stätte fände
Beim lichten Tagesschein!«
Die grauen Nibelungen,
Sie schaun gar höhnisch drein.
Und wie er späht am Ufer,
Und wie er sucht das Wort,
Da schließen sich die Wellen,
Verschwunden ist der Hort.
Allnächtlich weilt der Schiffer
Nun auf des Stromes Fluth,
Er sucht bei Loreleis Tönen
Den Hort, der unten ruht.
Doch einmal treibt der Nachen
Verlassen hin und her,
Und bei dem Horte sitzet
Ein bleicher Hüter mehr.