Tausend Libellen umgaukeln den Menschen und schillern und locken,
Aber die schönste ist grau, wenn er sie endlich erhascht.
Wäre es anders und schmückte der goldene Staub, der die Flügel
Jeder schweifenden ziert, eine gefangene nur;
Glänzte das Gut, das wir haben, wie jenes, welches uns mangelt,
Stände das Gut, das uns fehlt, nackt vor den Blicken, wie dies:
Welch ein Heil für uns alle! Wir würden nicht töricht verlangen
Und des bescheidensten Glücks ruhig und still uns erfreun!
Der Mensch und die Güter des Lebens
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
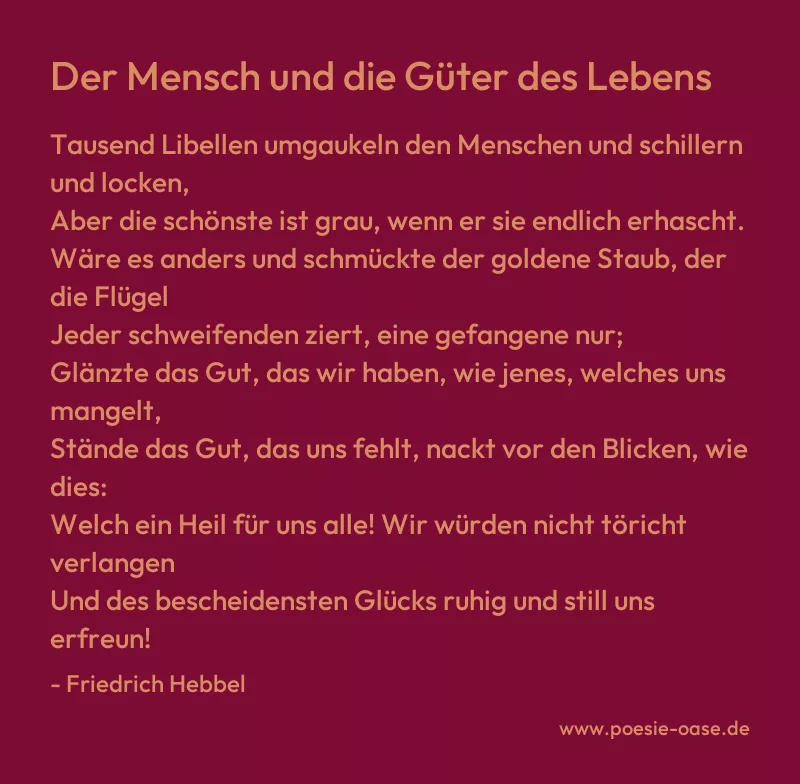
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Mensch und die Güter des Lebens“ von Friedrich Hebbel reflektiert über die Natur des menschlichen Verlangens und die Unzufriedenheit, die oft aus dem Streben nach Glück und Besitz resultiert. Es beginnt mit einem bildhaften Vergleich: Tausende Libellen, Sinnbild für die Güter und Freuden des Lebens, umtanzen den Menschen und verlocken ihn. Doch sobald er eine ergreift, entpuppt sich diese als unscheinbar und grau. Dieser Eingangsvers etabliert sofort ein zentrales Thema: Die Unfähigkeit des Menschen, sich an dem zu erfreuen, was er hat, und seine ständige Sehnsucht nach dem, was er nicht besitzt.
Im zweiten Teil des Gedichts wird diese Beobachtung vertieft. Hebbel entwirft eine hypothetische Welt, in der die Dinge, die wir bereits haben, so verlockend und glänzend wären wie die, nach denen wir uns sehnen. Gleichzeitig sollten die Güter, die uns fehlen, ihre Attraktivität verlieren und nackt und unansehnlich vor uns erscheinen. Durch diesen Kontrast verdeutlicht Hebbel die menschliche Tendenz, den Wert der Dinge zu untergraben, sobald sie im eigenen Besitz sind. Wir konzentrieren uns auf das, was uns fehlt, und übersehen oder entwerten das, was wir bereits haben. Diese Unfähigkeit, den gegenwärtigen Zustand zu schätzen, führt zu einem Kreislauf des Verlangens und der Unzufriedenheit.
Die poetische Sprache des Gedichts ist präzise und bildhaft. Hebbel verwendet Metaphern wie „Libellen“ und „goldener Staub“, um die flüchtige und trügerische Natur der Güter des Lebens zu veranschaulichen. Die Wiederholung der Worte „Gut“ und „Glück“ im gesamten Gedicht unterstreicht die zentrale Thematik. Der Appell am Ende des Gedichts, sich am bescheidenen Glück zu erfreuen, ist eine subtile, aber eindringliche Botschaft. Sie deutet an, dass die Quelle des Glücks nicht im äußeren Besitz, sondern in der inneren Zufriedenheit und der Fähigkeit liegt, das zu schätzen, was man hat.
Hebbel verbindet in diesem Gedicht philosophische Tiefe mit ästhetischer Schönheit. Es ist eine Reflexion über die menschliche Natur, die uns dazu anregen soll, unser eigenes Streben nach Glück zu hinterfragen. Die letzte Zeile ist ein Aufruf zur Bescheidenheit und zur Dankbarkeit. Das Gedicht erinnert uns daran, dass wahres Glück nicht in der Erlangung neuer Güter liegt, sondern in der Fähigkeit, das Vorhandene zu würdigen und sich an den einfachen Freuden des Lebens zu erfreuen. Es ist ein Plädoyer für ein Leben, das von innerem Frieden und Zufriedenheit geprägt ist, statt von rastlosem Streben und unerfüllten Wünschen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
