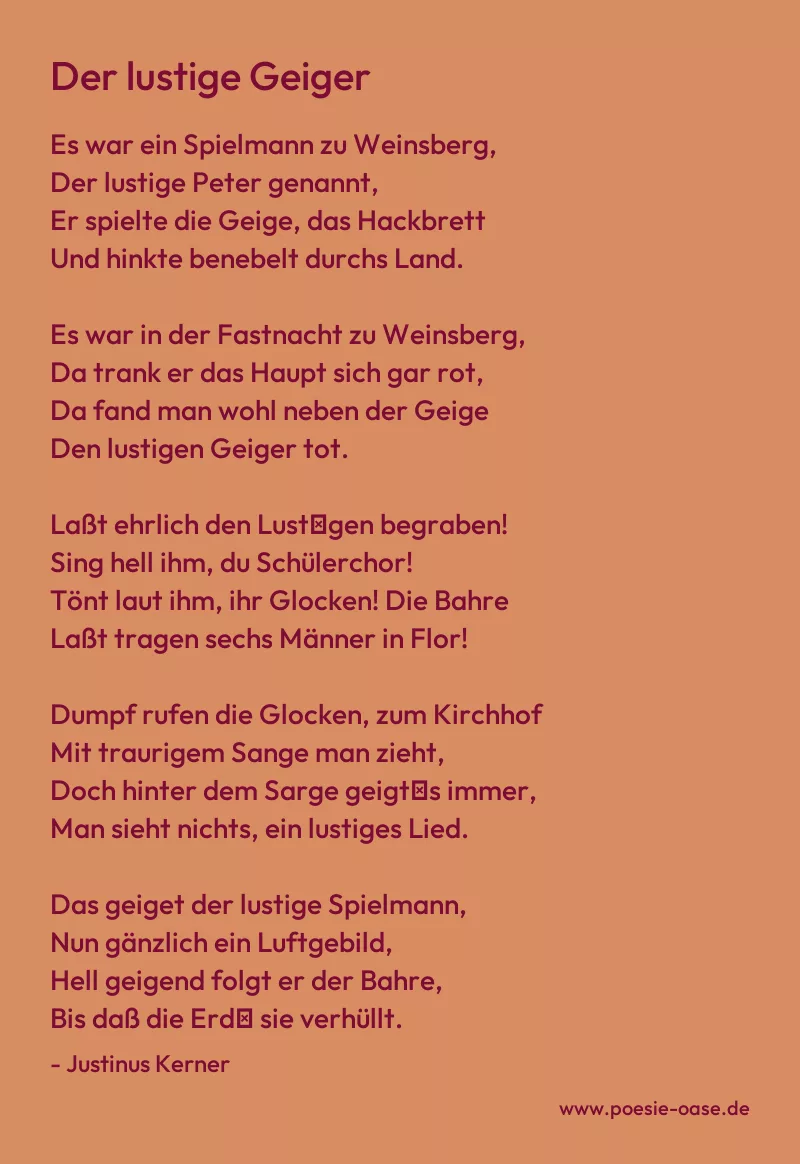Der lustige Geiger
Es war ein Spielmann zu Weinsberg,
Der lustige Peter genannt,
Er spielte die Geige, das Hackbrett
Und hinkte benebelt durchs Land.
Es war in der Fastnacht zu Weinsberg,
Da trank er das Haupt sich gar rot,
Da fand man wohl neben der Geige
Den lustigen Geiger tot.
Laßt ehrlich den Lust′gen begraben!
Sing hell ihm, du Schülerchor!
Tönt laut ihm, ihr Glocken! Die Bahre
Laßt tragen sechs Männer in Flor!
Dumpf rufen die Glocken, zum Kirchhof
Mit traurigem Sange man zieht,
Doch hinter dem Sarge geigt′s immer,
Man sieht nichts, ein lustiges Lied.
Das geiget der lustige Spielmann,
Nun gänzlich ein Luftgebild,
Hell geigend folgt er der Bahre,
Bis daß die Erd′ sie verhüllt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
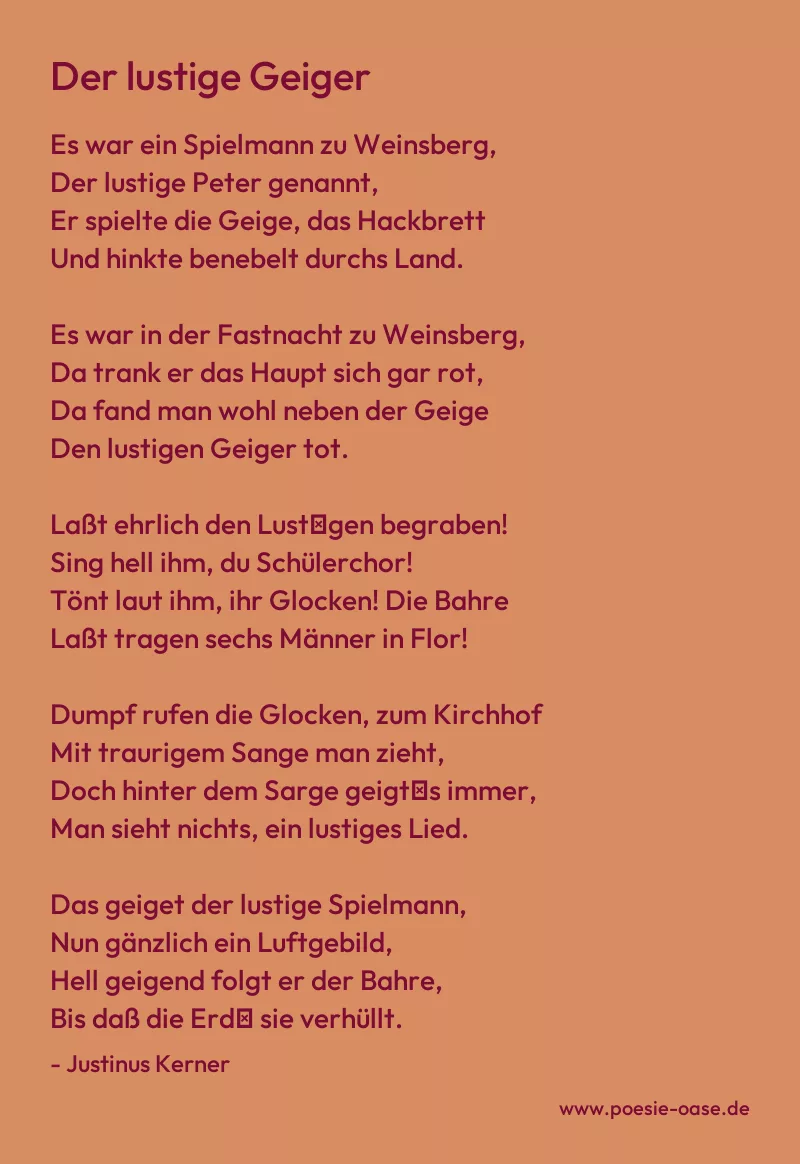
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der lustige Geiger“ von Justinus Kerner erzählt eine Geschichte über den Tod und die unaufhaltsame Lebendigkeit der Kunst. Es beginnt mit einer Beschreibung des Spielmanns Peter, einer Figur, die durch das Land zieht, Geige und Hackbrett spielt und dabei betrunken ist. Der erste Teil des Gedichts etabliert Peter als eine lebensfrohe, wenn auch etwas lose Persönlichkeit, die sich dem Genuss hingibt.
Der zweite Abschnitt beschreibt Peters Tod in der Fastnacht. Er ist betrunken und wird schließlich tot aufgefunden, was auf ein exzessives Leben und einen plötzlichen Abschied hindeutet. Der Tod, wie er dargestellt wird, wirkt abrupt und unerwartet, verstärkt durch die ironische Gegenüberstellung von „lustig“ und „tot“. Der Übergang von Leben zu Tod wird jedoch nicht pathetisch oder dramatisch dargestellt, sondern mit einer gewissen Nüchternheit, was die Bedeutung des folgenden Abschnitts hervorhebt.
Die dritte Strophe wendet sich der Beerdigung zu und gibt Anweisungen, wie man den Verstorbenen ehren soll. Der Appell an den Schülerchor und die Glocken unterstreicht die Bedeutung des Gemeinschaftsgefühls und der Wertschätzung des Lebens. Der „lustige Geiger“ wird mit Respekt behandelt, indem seine Bahre von Männern in Flor getragen wird. Die Trauergemeinde ist angewiesen, ein helles Lied zu singen, was auf das Verlangen hindeutet, das Andenken des Verstorbenen mit Freude zu bewahren, anstatt in tiefem Leid zu verharren.
Die beiden letzten Strophen nehmen eine überraschende Wendung: Hinter dem Sarg erklingt weiterhin Musik. Peter, nun ein „Luftgebild“, also eine Geistgestalt, spielt weiter Geige und begleitet seine eigene Bahre bis ins Grab. Diese poetische Wendung hebt die Unsterblichkeit der Kunst hervor. Der Spielmann ist tot, aber seine Musik, seine Lebensfreude, setzt sich fort. Das Gedicht endet mit einem Gefühl der Hoffnung und der ewigen Präsenz der Kunst, die über den Tod hinauswirkt.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.