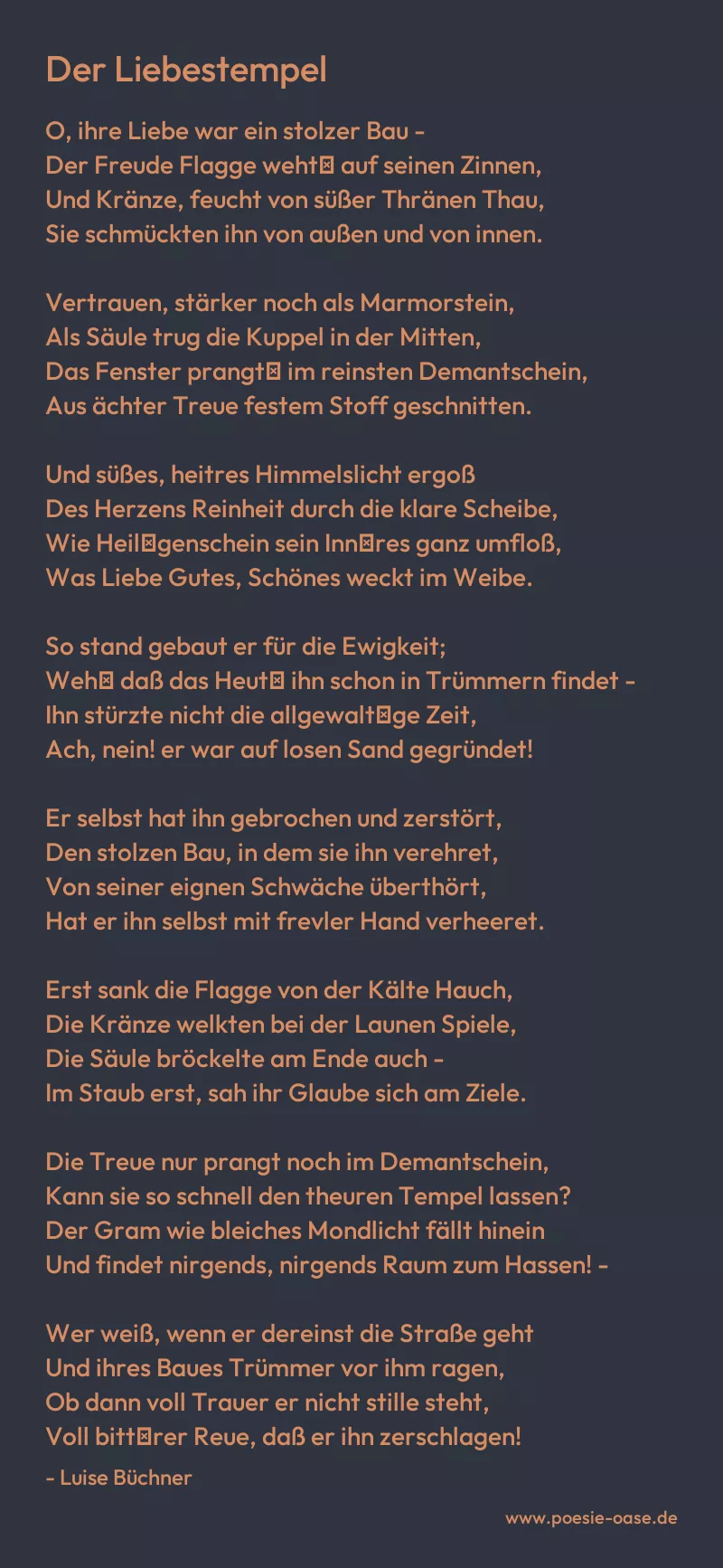O, ihre Liebe war ein stolzer Bau –
Der Freude Flagge weht′ auf seinen Zinnen,
Und Kränze, feucht von süßer Thränen Thau,
Sie schmückten ihn von außen und von innen.
Vertrauen, stärker noch als Marmorstein,
Als Säule trug die Kuppel in der Mitten,
Das Fenster prangt′ im reinsten Demantschein,
Aus ächter Treue festem Stoff geschnitten.
Und süßes, heitres Himmelslicht ergoß
Des Herzens Reinheit durch die klare Scheibe,
Wie Heil′genschein sein Inn′res ganz umfloß,
Was Liebe Gutes, Schönes weckt im Weibe.
So stand gebaut er für die Ewigkeit;
Weh′ daß das Heut′ ihn schon in Trümmern findet –
Ihn stürzte nicht die allgewalt′ge Zeit,
Ach, nein! er war auf losen Sand gegründet!
Er selbst hat ihn gebrochen und zerstört,
Den stolzen Bau, in dem sie ihn verehret,
Von seiner eignen Schwäche überthört,
Hat er ihn selbst mit frevler Hand verheeret.
Erst sank die Flagge von der Kälte Hauch,
Die Kränze welkten bei der Launen Spiele,
Die Säule bröckelte am Ende auch –
Im Staub erst, sah ihr Glaube sich am Ziele.
Die Treue nur prangt noch im Demantschein,
Kann sie so schnell den theuren Tempel lassen?
Der Gram wie bleiches Mondlicht fällt hinein
Und findet nirgends, nirgends Raum zum Hassen! –
Wer weiß, wenn er dereinst die Straße geht
Und ihres Baues Trümmer vor ihm ragen,
Ob dann voll Trauer er nicht stille steht,
Voll bitt′rer Reue, daß er ihn zerschlagen!