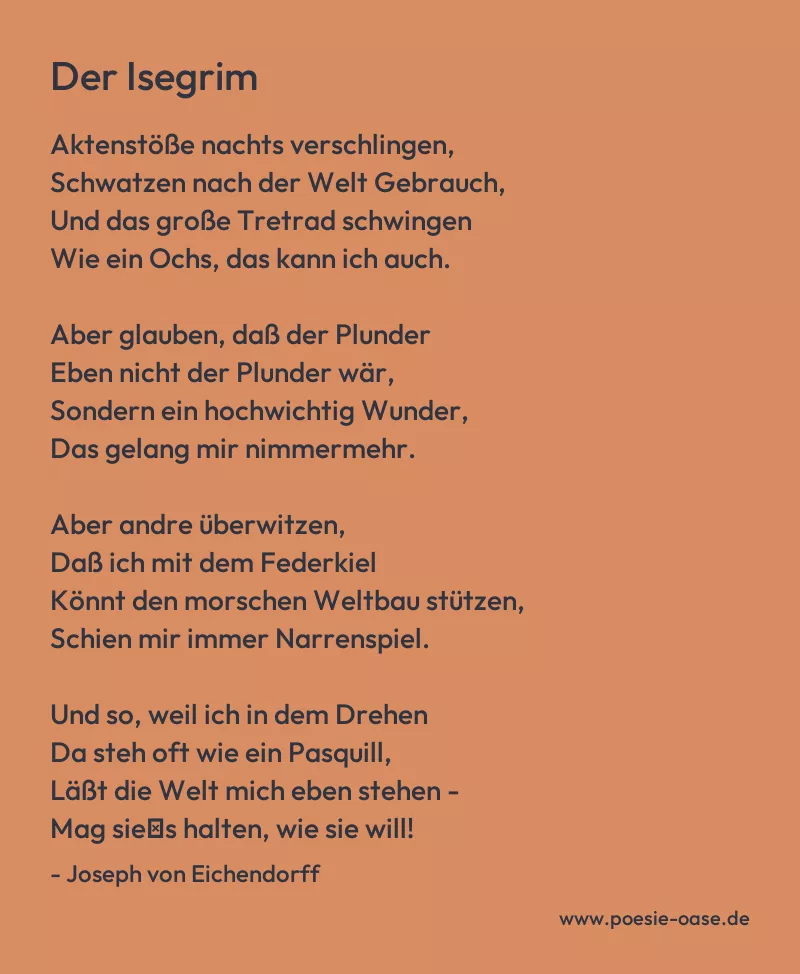Der Isegrim
Aktenstöße nachts verschlingen,
Schwatzen nach der Welt Gebrauch,
Und das große Tretrad schwingen
Wie ein Ochs, das kann ich auch.
Aber glauben, daß der Plunder
Eben nicht der Plunder wär,
Sondern ein hochwichtig Wunder,
Das gelang mir nimmermehr.
Aber andre überwitzen,
Daß ich mit dem Federkiel
Könnt den morschen Weltbau stützen,
Schien mir immer Narrenspiel.
Und so, weil ich in dem Drehen
Da steh oft wie ein Pasquill,
Läßt die Welt mich eben stehen –
Mag sie′s halten, wie sie will!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
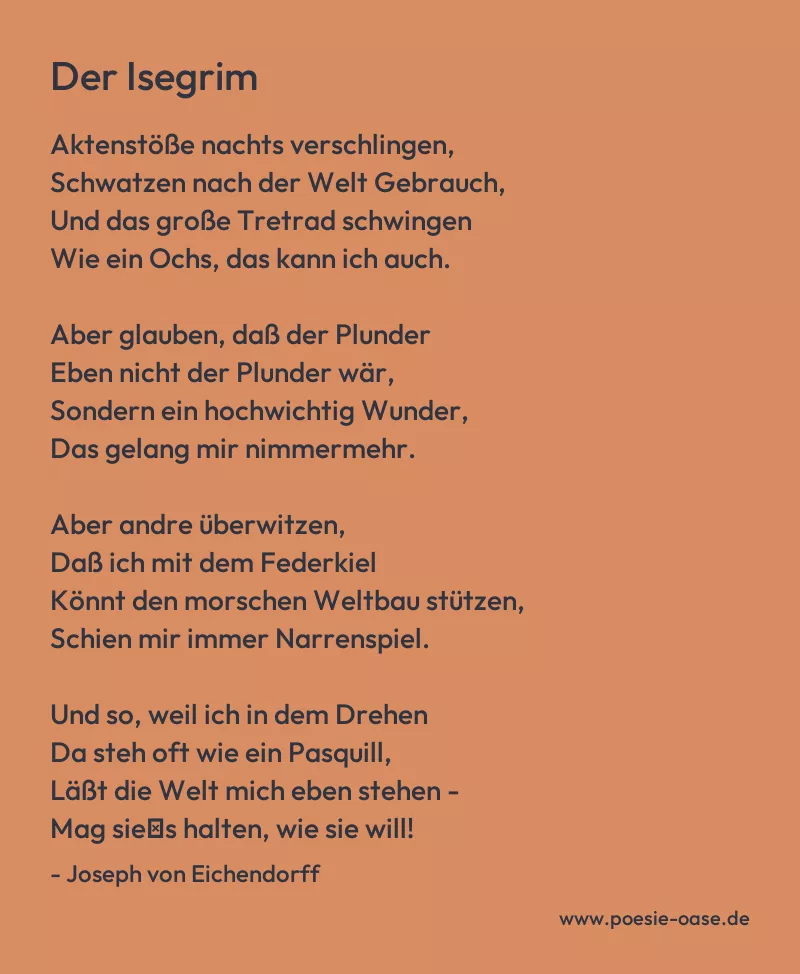
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Isegrim“ von Joseph von Eichendorff ist eine melancholische Reflexion über das eigene Unvermögen, sich an den Konventionen und dem Geschäft der Welt zu beteiligen. Der Titel „Der Isegrim“ – eine Bezeichnung für den Wolf in der Fabelwelt – deutet bereits eine gewisse Distanz und das Außenseitertum des lyrischen Ichs an, das sich selbst als Beobachter und Kritiker der menschlichen Geschäftigkeit sieht. Das Gedicht ist in vier Strophen unterteilt, die jeweils einen Aspekt des Scheiterns an den Erwartungen der Gesellschaft beleuchten.
Die erste Strophe beschreibt die Fähigkeit, oberflächliche Tätigkeiten auszuführen: „Aktenstöße nachts verschlingen, / Schwatzen nach der Welt Gebrauch, / Und das große Tretrad schwingen / Wie ein Ochs, das kann ich auch.“ Hier wird die Welt der Geschäftigkeit und des Konformismus karikiert. Das lyrische Ich gibt vor, die im Berufsleben üblichen Handlungen zu beherrschen, aber er betont gleichzeitig, dass es sich um mechanische Tätigkeiten handelt, die ihm keine Erfüllung bringen. Das „Tretrad“ steht symbolisch für die monotone, sinnlose Arbeit, die wie ein Ochse ausgeführt wird. Die Ironie liegt darin, dass das Ich zwar die Tätigkeiten beherrscht, aber nicht die innere Überzeugung und den Sinn darin findet.
Die zweite Strophe offenbart die Unfähigkeit, an den übertriebenen Ansprüchen der Gesellschaft teilzunehmen. „Aber glauben, daß der Plunder / Eben nicht der Plunder wär, / Sondern ein hochwichtig Wunder, / Das gelang mir nimmermehr.“ Hier wird die kritische Haltung gegenüber der Idealisierung des materiellen Erfolgs deutlich. Das lyrische Ich weigert sich, den „Plunder“ (den Besitz, die materielle Welt) als etwas Bedeutendes anzusehen. Er kann die Überzeugung der anderen, dass dieser Plunder ein „hochwichtig Wunder“ sei, nicht teilen. Dies deutet auf eine tiefe Skepsis gegenüber den Werten der Gesellschaft hin, die sich oft auf Oberflächlichkeiten und materiellem Gewinn aufbaut.
In der dritten Strophe wird die Ablehnung des übertriebenen Vertrauens in menschliche Fähigkeiten thematisiert. „Aber andre überwitzen, / Daß ich mit dem Federkiel / Könnt den morschen Weltbau stützen, / Schien mir immer Narrenspiel.“ Das lyrische Ich kritisiert hier die Überheblichkeit der Menschen, die glauben, mit ihren begrenzten Fähigkeiten die Welt retten zu können. Die Metapher vom „morschen Weltbau“ deutet auf eine pessimistische Sicht auf die Gesellschaft hin, die er als zerbrechlich und zum Untergang verurteilt betrachtet. Die Verwendung des „Federkiels“ symbolisiert die Macht des Wortes, die hier als unfähig dargestellt wird, die Welt zu verändern oder zu verbessern.
Die letzte Strophe fasst die Haltung des lyrischen Ichs zusammen. „Und so, weil ich in dem Drehen / Da steh oft wie ein Pasquill, / Läßt die Welt mich eben stehen – / Mag sie′s halten, wie sie will!“ Hier wird das Außenseitertum endgültig akzeptiert. Das lyrische Ich fühlt sich als „Pasquill“, als eine Spottfigur, die von der Welt ignoriert wird. Es resigniert gegenüber der gesellschaftlichen Ablehnung und gibt sich der Haltung hin, von der Welt „stehen gelassen“ zu werden. Der letzte Vers „Mag sie′s halten, wie sie will!“ drückt eine gewisse Freiheit und Unabhängigkeit aus, die aus der Akzeptanz des eigenen Scheiterns resultiert. Das Gedicht ist somit eine tiefgründige Reflexion über die Entfremdung des Individuums von der Gesellschaft und die Schwierigkeit, sich in einer Welt zu behaupten, die von oberflächlichen Werten geprägt ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.