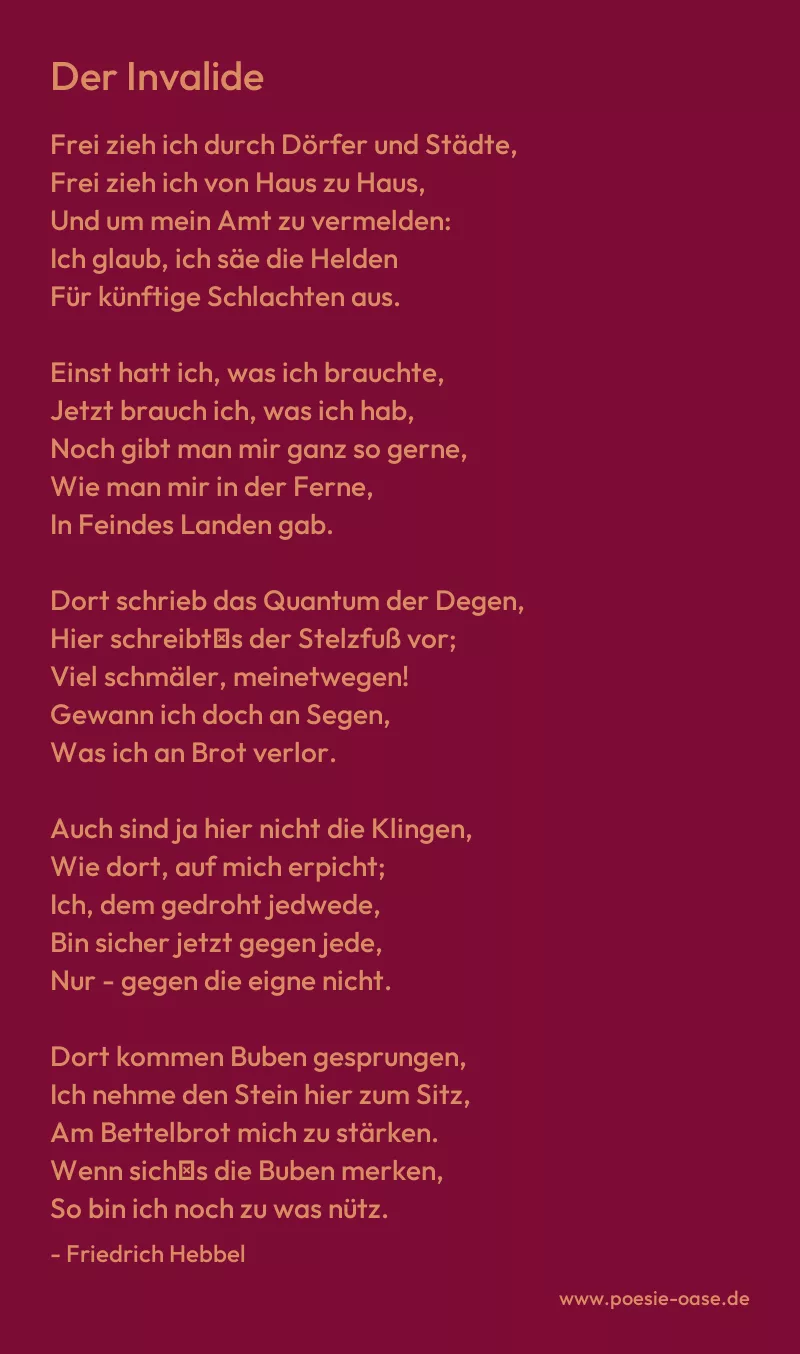Der Invalide
Frei zieh ich durch Dörfer und Städte,
Frei zieh ich von Haus zu Haus,
Und um mein Amt zu vermelden:
Ich glaub, ich säe die Helden
Für künftige Schlachten aus.
Einst hatt ich, was ich brauchte,
Jetzt brauch ich, was ich hab,
Noch gibt man mir ganz so gerne,
Wie man mir in der Ferne,
In Feindes Landen gab.
Dort schrieb das Quantum der Degen,
Hier schreibt′s der Stelzfuß vor;
Viel schmäler, meinetwegen!
Gewann ich doch an Segen,
Was ich an Brot verlor.
Auch sind ja hier nicht die Klingen,
Wie dort, auf mich erpicht;
Ich, dem gedroht jedwede,
Bin sicher jetzt gegen jede,
Nur – gegen die eigne nicht.
Dort kommen Buben gesprungen,
Ich nehme den Stein hier zum Sitz,
Am Bettelbrot mich zu stärken.
Wenn sich′s die Buben merken,
So bin ich noch zu was nütz.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
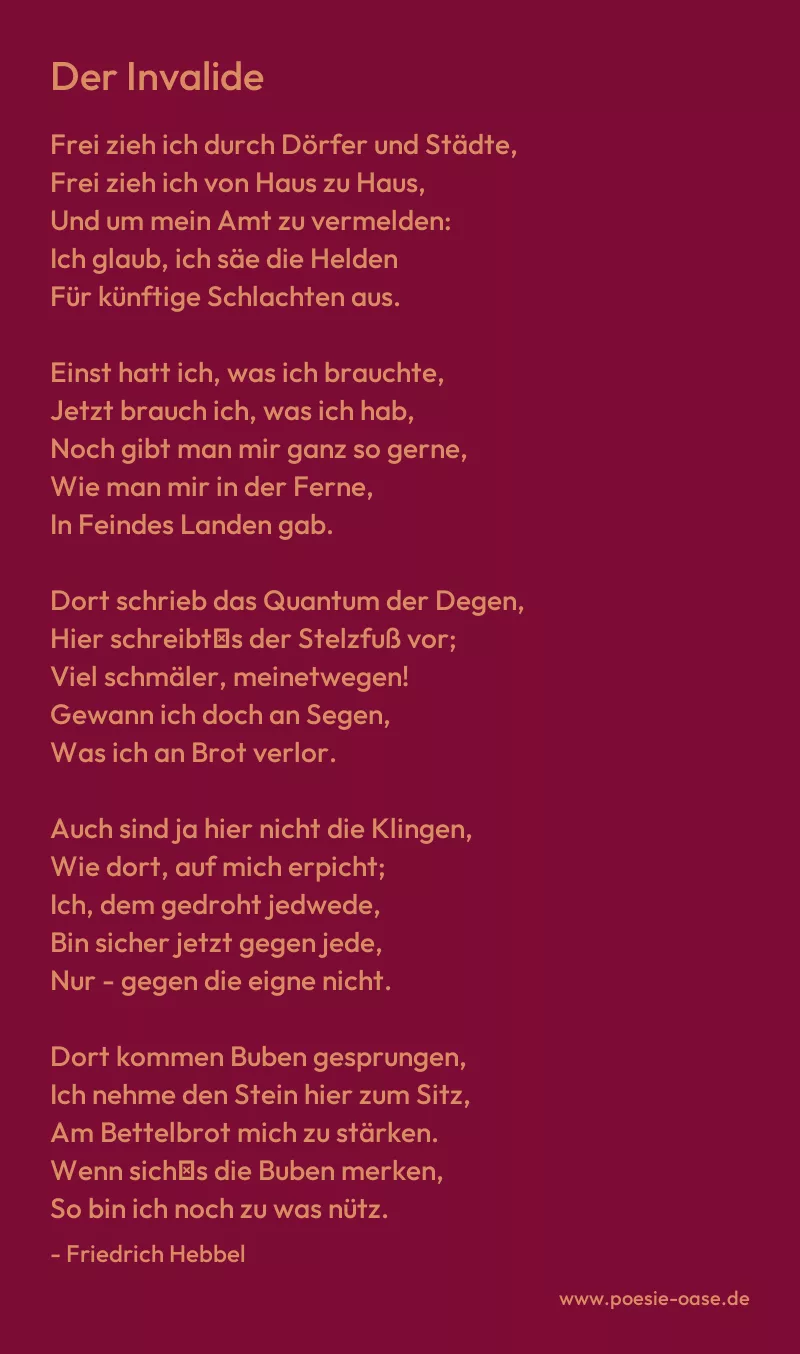
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Invalide“ von Friedrich Hebbel handelt von einem Kriegsinvaliden, der von seinen Erfahrungen und der Veränderung seines Lebens nach dem Verlust seiner körperlichen Unversehrtheit berichtet. Der Titel und der Inhalt weisen auf die körperliche und gesellschaftliche Situation des Protagonisten hin, der sich in seinem Leben nach dem Krieg neu orientieren muss.
In den ersten beiden Strophen wird das Leben des Invaliden nach dem Krieg skizziert. Er zieht frei durch Dörfer und Städte, was auf eine gewisse Ungebundenheit hindeutet, aber auch auf eine gewisse Heimatlosigkeit. Er sieht seine Aufgabe darin, „Helden für künftige Schlachten“ zu säen, eine ambivalente Aussage, da sie einerseits auf eine patriotische Gesinnung hindeuten könnte, andererseits aber auch die Zirkularität und Sinnlosigkeit von Krieg und Gewalt kritisch beleuchten kann. Der Invalide erlebt eine Veränderung in der Wahrnehmung seiner Person durch die Gesellschaft. Während er einst „brauchte, was er hatte“, braucht er nun, was er hat. Dies deutet auf eine Reduzierung seiner Möglichkeiten und eine Abhängigkeit von der Mildtätigkeit anderer hin, die aber in der Erfahrung des Invalide scheinbar gleichbleibt.
Die dritte und vierte Strophe thematisieren die innere Verarbeitung des Krieges und die veränderte Lebensrealität. Der Invalide vergleicht die „Quantität der Degen“ im Krieg mit seinem „Stelzfuß“, der nun seine Geschichte schreibt. Dies deutet auf eine Verschiebung von der aktiven Beteiligung am Krieg hin zu einer passiven Rolle, in der er das Erlebte verarbeiten und weitergeben muss. Der Verlust von „Brot“ wird durch einen Gewinn an „Segen“ aufgewogen, was auf eine spirituelle oder emotionale Bereicherung hindeutet, die durch die Erfahrungen des Krieges und die daraus resultierende Verwundbarkeit entstanden ist. Die letzte Zeile der vierten Strophe offenbart die eigentliche Tragik: Die einzige Bedrohung, die noch besteht, geht vom Invalide selbst aus. Dies könnte bedeuten, dass die seelischen Wunden und die innere Zerrissenheit des Krieges ihn mehr belasten als die äußeren Umstände.
In der letzten Strophe findet die Geschichte ihren Abschluss. Der Invalide findet Zuflucht und Hilfe in der Gesellschaft, die er auch an seinen körperlichen Zustand angepasst weiter unterstützen kann. Die „Buben“, die ihn „merken“, könnten die nächste Generation von Kriegern symbolisieren, die der Invalide beeinflussen kann. Das Gedicht endet mit einer Note der Selbstbehauptung und des Überlebenswillens. Obwohl er körperlich eingeschränkt ist, kann er weiterhin einen Beitrag leisten und seine Erfahrungen weitergeben. Dies deutet auf eine tiefe Auseinandersetzung mit den Themen Krieg, Verlust, Trauma und Resilienz hin und stellt eine Reflexion über die bleibenden Auswirkungen von Krieg und Gewalt auf das Individuum und die Gesellschaft dar.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.