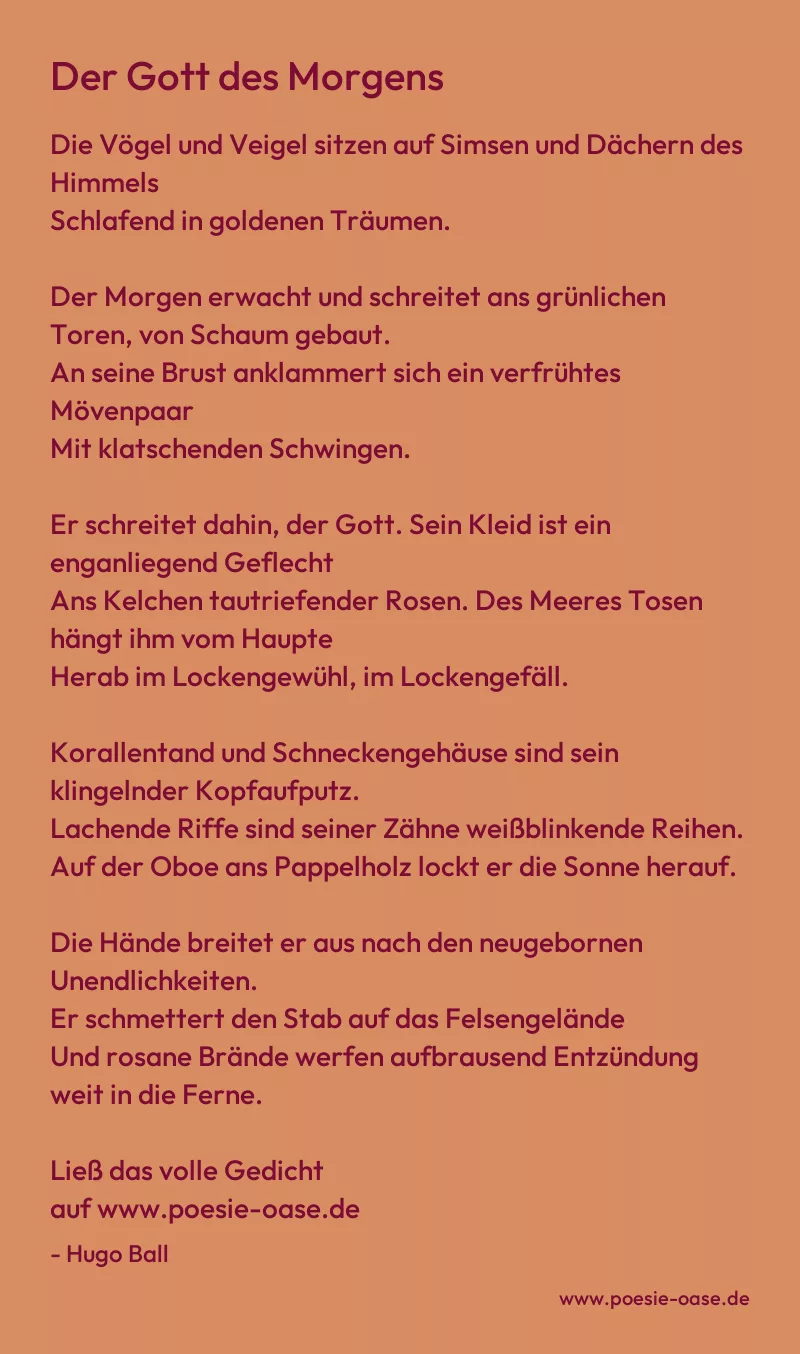Die Vögel und Veigel sitzen auf Simsen und Dächern des Himmels
Schlafend in goldenen Träumen.
Der Morgen erwacht und schreitet ans grünlichen Toren, von Schaum gebaut.
An seine Brust anklammert sich ein verfrühtes Mövenpaar
Mit klatschenden Schwingen.
Er schreitet dahin, der Gott. Sein Kleid ist ein enganliegend Geflecht
Ans Kelchen tautriefender Rosen. Des Meeres Tosen hängt ihm vom Haupte
Herab im Lockengewühl, im Lockengefäll.
Korallentand und Schneckengehäuse sind sein klingelnder Kopfaufputz.
Lachende Riffe sind seiner Zähne weißblinkende Reihen.
Auf der Oboe ans Pappelholz lockt er die Sonne herauf.
Die Hände breitet er aus nach den neugebornen Unendlichkeiten.
Er schmettert den Stab auf das Felsengelände
Und rosane Brände werfen aufbrausend Entzündung weit in die Ferne.
Die Fenster und die Fassaden der Wolkengebäude stehen in Flammen.
Die Länder und Städte der Menschen schlafen noch wie vergessenes Spielzeug.
Über die Ebene schürfet des Gottes Schuh auf rollendem Perlengestein.
Wolken und Wellen, Weiden und Winde singen sein Lied ihm nach.
Die Hyazinthen der Gärten niesen sich wach und schau′n ihm verwundert ins Auge.
Die Gräser recken die grünen Schwerter und fechten ein nasses Getümmel.
Ungeduldig tanzet der Gott. Ihm ists nicht genug, daß die Erde
Dem Tag ihn entgegenträgt gleich einer Lustfregatte.
Auf dem Verdeck des segelnden Schiffes noch stürmt er dahin, der Gott,
Lachend und jauchzend, rufend und weckend, die Syrinx blasend
Mit hellem Getön.