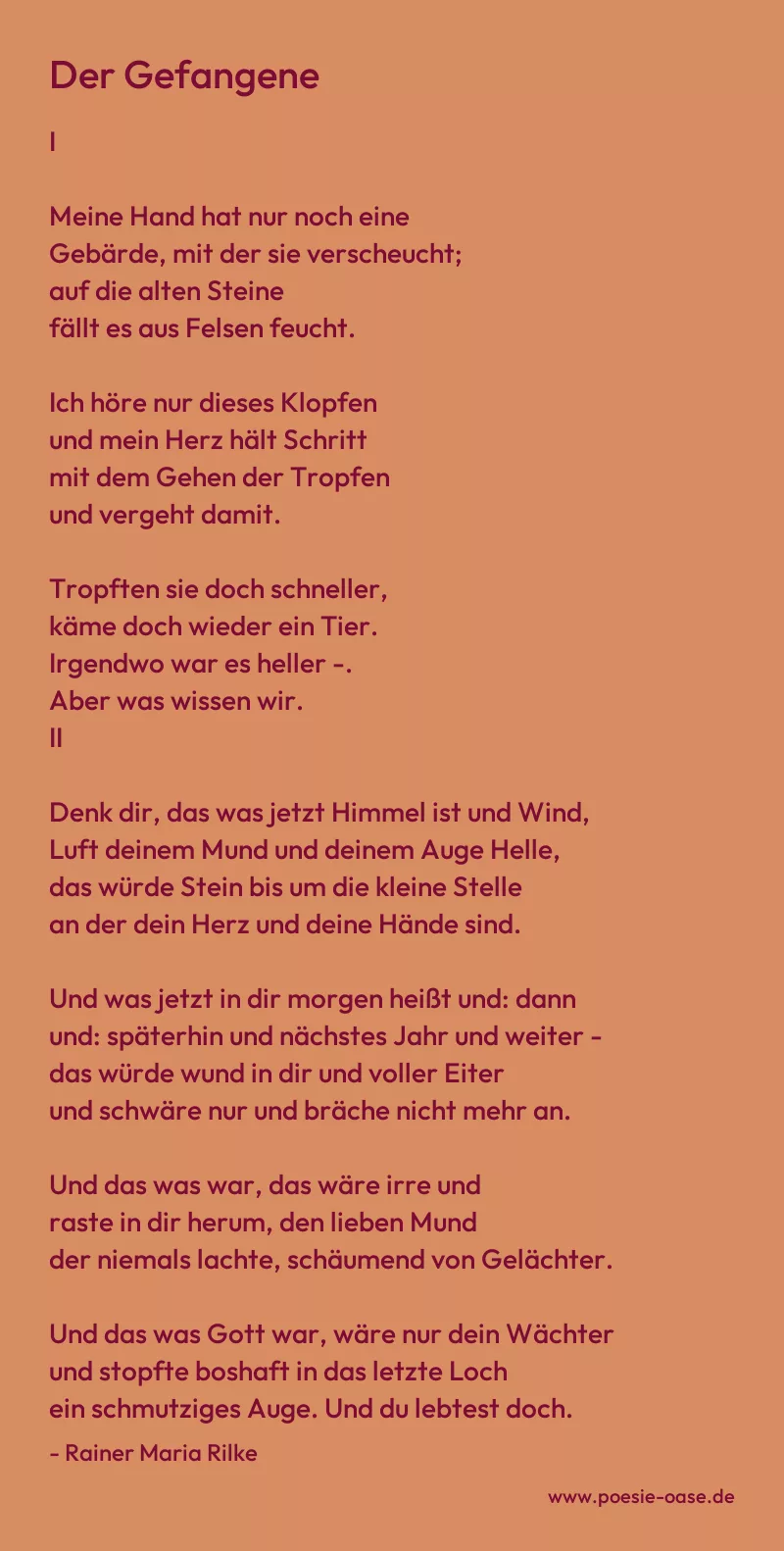Berge & Täler, Freiheit & Sehnsucht, Gegenwart, Götter, Helden & Prinzessinnen, Herbst, Lachen, Natur, Religion, Wagnisse, Wissenschaft & Technik
Der Gefangene
I
Meine Hand hat nur noch eine
Gebärde, mit der sie verscheucht;
auf die alten Steine
fällt es aus Felsen feucht.
Ich höre nur dieses Klopfen
und mein Herz hält Schritt
mit dem Gehen der Tropfen
und vergeht damit.
Tropften sie doch schneller,
käme doch wieder ein Tier.
Irgendwo war es heller -.
Aber was wissen wir.
II
Denk dir, das was jetzt Himmel ist und Wind,
Luft deinem Mund und deinem Auge Helle,
das würde Stein bis um die kleine Stelle
an der dein Herz und deine Hände sind.
Und was jetzt in dir morgen heißt und: dann
und: späterhin und nächstes Jahr und weiter –
das würde wund in dir und voller Eiter
und schwäre nur und bräche nicht mehr an.
Und das was war, das wäre irre und
raste in dir herum, den lieben Mund
der niemals lachte, schäumend von Gelächter.
Und das was Gott war, wäre nur dein Wächter
und stopfte boshaft in das letzte Loch
ein schmutziges Auge. Und du lebtest doch.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
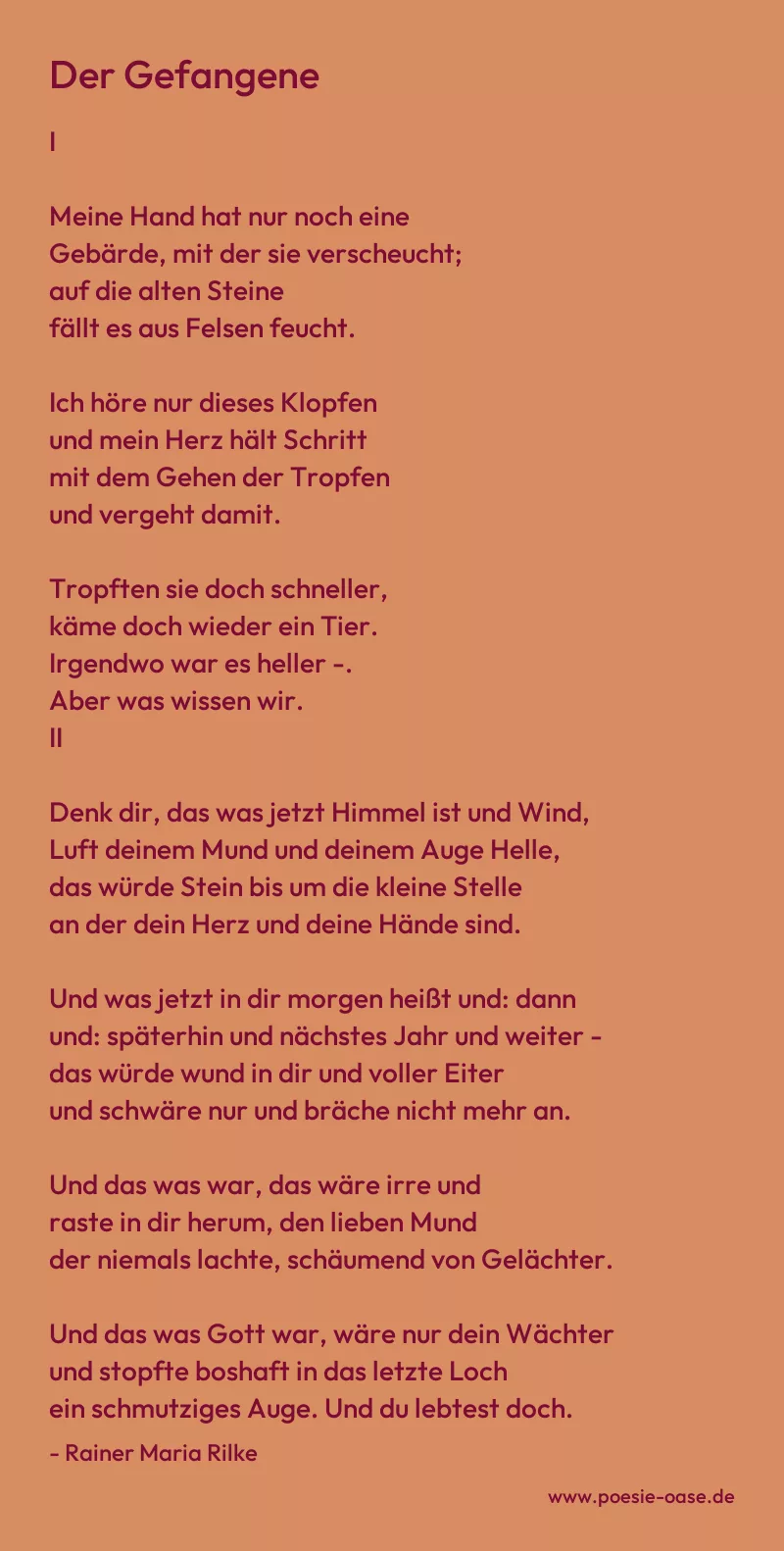
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Gefangene“ von Rainer Maria Rilke entfaltet in zwei Teilen ein beklemmendes Bild der Isolation und des Verlusts. Der erste Teil konzentriert sich auf die physische Erfahrung der Gefangenschaft, während der zweite Teil die mentale und spirituelle Zerstörung des Gefangenen thematisiert. Das Gedicht ist durch eine düstere Stimmung geprägt, die durch die Wahl der Worte und die Verwendung von Bildern des Verfalls und der Hoffnungslosigkeit verstärkt wird.
Der erste Teil, der durch die Verwendung von Bildern wie „alte Steine“, „Felsen feucht“ und „Klopfen“ charakterisiert ist, vermittelt ein Gefühl der Enge und Monotonie. Die einzige Bewegung, die im Gedicht stattfindet, ist das langsame Tropfen des Wassers, das den Herzschlag des Gefangenen nachahmt und seine Vergeblichkeit betont. Die Zeile „käme doch wieder ein Tier“ deutet auf eine Sehnsucht nach Leben und Abwechslung hin, die jedoch durch die düstere Umgebung und die aussichtslose Situation des Gefangenen untergraben wird. Der Wunsch nach Helligkeit in „Irgendwo war es heller -“ wird zu einer flüchtigen Erinnerung an eine Welt, die sich außerhalb des Gefängnisses befindet.
Der zweite Teil erweitert die Gefangenschaft auf eine existenzielle Ebene. Hier wird die Freiheit des Gefangenen, sein Gefühl von Zeit, seine Emotionen und seine Beziehung zu Gott zerstört. Rilke zeichnet das Bild einer Welt, in der die Zeit stagniert und die Gefühle in Eiter umschlagen. Das „was war“ wird zu einer unkontrollierbaren Kraft, die den Gefangenen mit irrem Gelächter quält, während Gott, der nun zum „Wächter“ degradiert ist, eine feindselige Figur darstellt. Diese düstere Vision verdeutlicht die vollständige Zerstörung der inneren Welt des Gefangenen.
Das Gedicht ist ein eindringliches Beispiel für Rilkes Fähigkeit, innere Zustände in poetische Bilder zu übersetzen. Die Verwendung von Metaphern und Symbolen, wie dem steinernen Gefängnis und den erstarrten Emotionen, erzeugt eine Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit und des Verlusts. Die Wiederholung bestimmter Wörter und die rhythmische Gestaltung des Gedichts verstärken diese Wirkung, wodurch der Leser in die beklemmende Welt des Gefangenen hineingezogen wird. Die abschließende Zeile „Und du lebtest doch“ betont die Tragik der Situation: Der Gefangene ist zwar physisch noch am Leben, aber seine Seele und sein Geist sind bereits dem Verfall anheimgefallen.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.