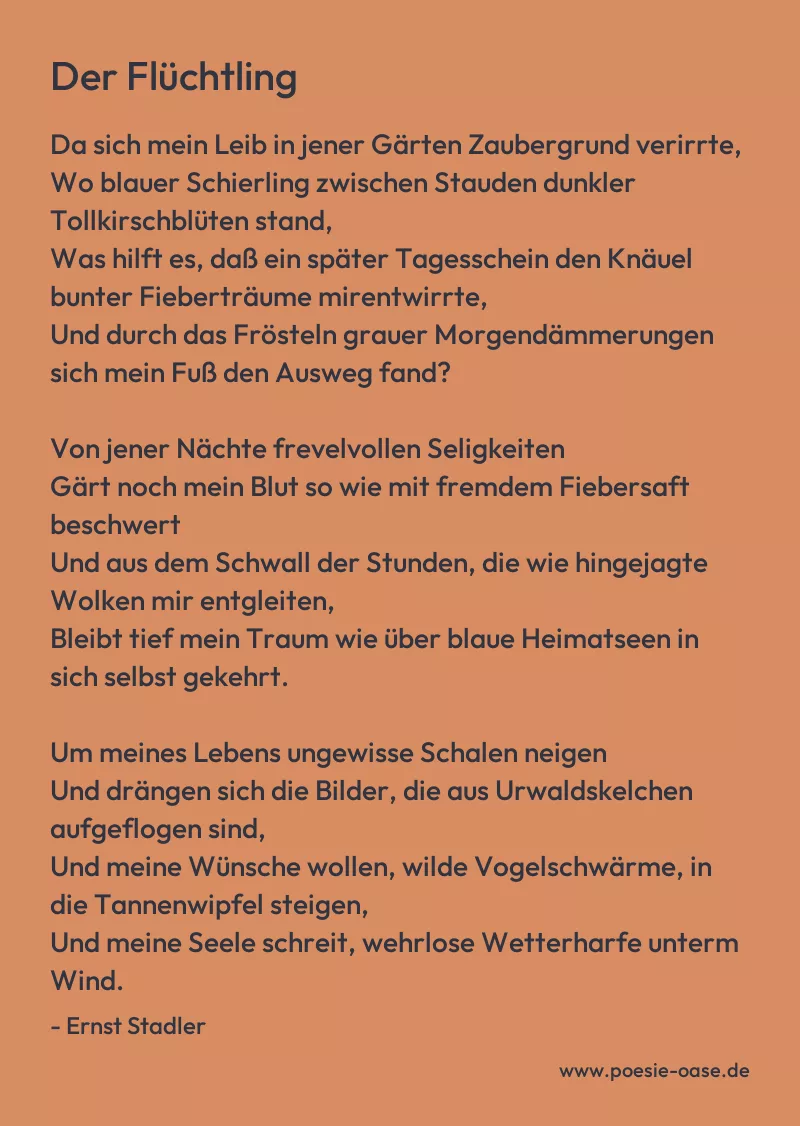Der Flüchtling
Da sich mein Leib in jener Gärten Zaubergrund verirrte,
Wo blauer Schierling zwischen Stauden dunkler Tollkirschblüten stand,
Was hilft es, daß ein später Tagesschein den Knäuel bunter Fieberträume mirentwirrte,
Und durch das Frösteln grauer Morgendämmerungen sich mein Fuß den Ausweg fand?
Von jener Nächte frevelvollen Seligkeiten
Gärt noch mein Blut so wie mit fremdem Fiebersaft beschwert
Und aus dem Schwall der Stunden, die wie hingejagte Wolken mir entgleiten,
Bleibt tief mein Traum wie über blaue Heimatseen in sich selbst gekehrt.
Um meines Lebens ungewisse Schalen neigen
Und drängen sich die Bilder, die aus Urwaldskelchen aufgeflogen sind,
Und meine Wünsche wollen, wilde Vogelschwärme, in die Tannenwipfel steigen,
Und meine Seele schreit, wehrlose Wetterharfe unterm Wind.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
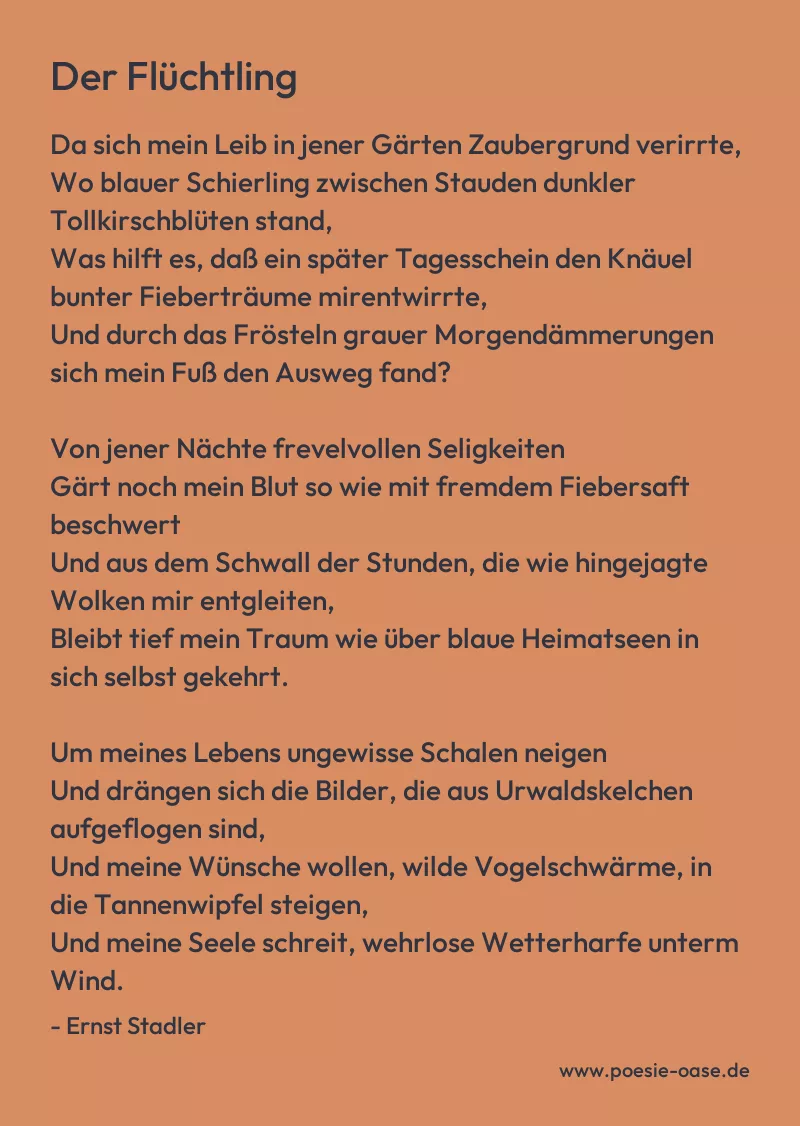
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Flüchtling“ von Ernst Stadler handelt von der Nachwirkung einer intensiven, möglicherweise rauschhaften Erfahrung und dem Gefühl des Entfremdetseins, das danach zurückbleibt. Der Titel deutet auf eine Flucht hin, wobei die eigentliche Flucht nicht von einem Ort, sondern von einem Zustand der Ekstase oder Verwirrung erfolgt. Der Dichter beschreibt, wie er sich in einem „Zaubergrund“ verirrt hat, einem Ort, der mit dunklen Pflanzen wie Schierling und Tollkirsche assoziiert wird, die Giftigkeit und Gefahr symbolisieren. Dies legt den Grundstein für eine Interpretation, die sich mit den Auswirkungen von Rausch, Leidenschaft oder einer intensiven, aber potenziell schädlichen Erfahrung auseinandersetzt.
In der ersten Strophe wird der Zustand des „Verirrens“ in diesem „Zaubergrund“ beschrieben. Der Dichter scheint aus diesem Zustand erwacht zu sein, wie durch den „späten Tagesschein“ und das „Frösteln grauer Morgendämmerungen“ angedeutet wird. Doch die Erinnerung an die Erfahrung, der „Knäuel bunter Fieberträume“, ist noch präsent. Die Zeilen suggerieren ein Gefühl des Verlorenseins und der Orientierungslosigkeit, das durch das Erleben einer intensiven Erfahrung erzeugt wurde, aus der man sich nur schwer lösen kann. Die Frage „Was hilft es…?“ zeigt die Vergeblichkeit des Versuchs, sich von den Nachwirkungen der Erfahrung zu befreien, die immer noch im Dichter nachhallen.
Die zweite Strophe vertieft diese Thematik, indem sie die Nachwirkungen der „frevelvollen Seligkeiten“ der „Nächte“ hervorhebt. Das Blut des Dichters ist „mit fremdem Fiebersaft beschwert“, ein starkes Bild für die anhaltende Wirkung der vergangenen Erfahrung. Das Verlangen nach dieser intensiven Erfahrung scheint noch zu bestehen, da der Dichter von einem „Schwall der Stunden“ spricht, die wie „hingejagte Wolken“ an ihm vorbeiziehen, während sein Traum „wie über blaue Heimatseen in sich selbst gekehrt“ ist. Dies deutet auf eine Sehnsucht nach einem Zustand, der in der Vergangenheit lag, hin und auf das Gefühl der Entfremdung von der Gegenwart.
Die abschließende Strophe verstärkt dieses Gefühl der Zerrissenheit. Bilder aus der Vergangenheit drängen sich auf, „die aus Urwaldskelchen aufgeflogen sind“. Die „Wünsche“ des Dichters werden mit „wilden Vogelschwärmen“ verglichen, die in die „Tannenwipfel steigen“, was auf eine Sehnsucht nach Freiheit und Ungebundenheit hinweist. Gleichzeitig schreit die Seele, „wehrlose Wetterharfe unterm Wind“, was die Verletzlichkeit und den Schmerz des Dichters verdeutlicht, der zwischen der Erinnerung an die Ekstase und der Realität des Entfremdetseins gefangen ist. Das Gedicht endet mit einem Gefühl der Unruhe und des Verlangens, ein Zustand, der durch die schmerzlichen Nachwirkungen einer vergangenen, intensiven Erfahrung verursacht wurde.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.