Was regt sich dort um Mitternacht?
Elz hat das Netz zu Strand gebracht,
Die Havel hegt viel Fische.
Da rufts von drüben mit fremdem Laut:
»Hol über!« so wüst daß Eulen graut,
Elz aber frägt: Wer ruft da?
»Hol über!« rufts mit grimmem Ton;
Ein andrer wär da bald entflohn,
Elz aber ruft: Wer seid ihr?
»Hol über!« rufts mit solcher Wut,
Daß her zum Nachen rauscht die Flut,
Elz aber nimmt das Ruder,
Kennt keine Furcht und keinen Schreck,
Er springt ins Schiff und rudert keck,
Bis er gelangt zum Strande.
Da schleppt sich herab aus wildem Wald
Eine riesig dunkle Graungestalt
Ins Schiff wie mit bleiernen Füßen,
So schwer, daß fast es niedergeht.
Doch Elz stößt ab das Boot und steht
Hochschwebend am andern Ende.
Wie auch das schwanke Holz erkracht,
Elz stehet fest und lenkts mit Macht
Hin durch den Strom der Havel.
Der Fremde blickt ihn furchtbar an,
Elz wieder ihn, als echter Mann,
Und schwingt gemach das Ruder.
Und wie er kommt zum andern Strand
Steigt schweren Tritts der Gast ans Land,
Elz aber heischt das Fährgeld.
»Es liegt im Schiff worin ich saß,
Den keiner zu fahren sich je vermaß
Als du allein, du Kühner!
Denn wisse, daß der Tod ich bin:
Ich ziehe vor Tage nach Gotin
Und alles wird da sterben.
Nur du sollst spät mich sonder Graun
Mit leichten Flügeln wiederschaun
Als sanften Seelenlöser.«
Der Fischer von Gotin
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
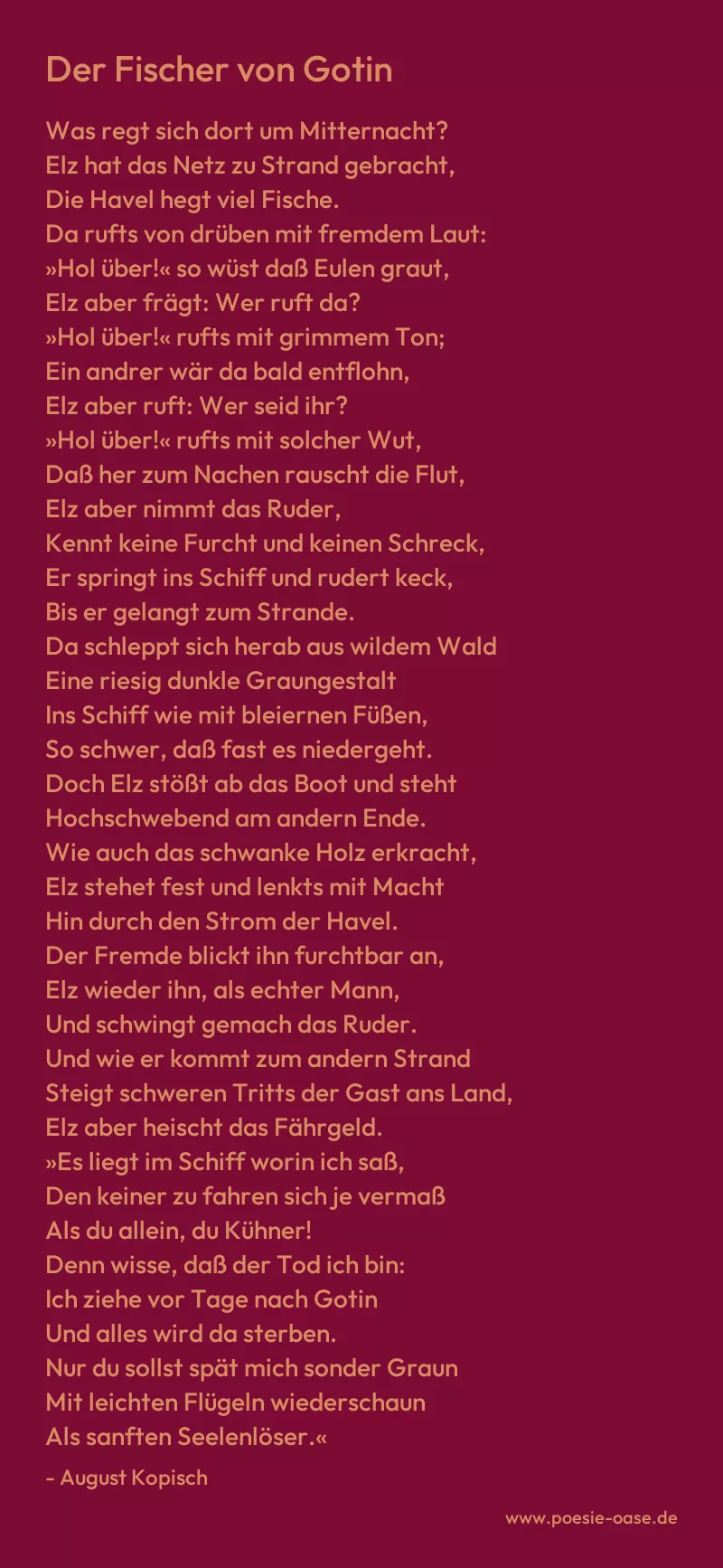
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Fischer von Gotin“ von August Kopisch ist eine düstere Ballade, die von Begegnung des Fischers Elz mit dem Tod handelt. Es entfaltet eine unheimliche Atmosphäre, indem es die nächtliche Szenerie am Havel-Ufer als Kulisse wählt und durch den Einsatz von Dialogen, Spannungsaufbau und dem Auftreten einer übernatürlichen Gestalt eine beklemmende Stimmung erzeugt. Die stetig wiederholte Aufforderung „Hol über!“ erzeugt von Beginn an ein Gefühl der Bedrohung und Unheimlichkeit, welches sich durch die Beschreibung des Fremden, der sich als der Tod zu erkennen gibt, noch verstärkt.
Die zentrale Botschaft des Gedichts liegt in der Konfrontation des Menschen mit dem Tod und der Thematisierung von Mut und Unerschrockenheit. Elz, der Fischer, verkörpert dabei den unerschrockenen Helden, der sich trotz der beängstigenden Umstände nicht von seiner Aufgabe abbringen lässt. Seine wiederholten Fragen und sein entschlossenes Handeln, wie das Festhalten des Ruders und die Forderung nach dem Fährgeld, zeigen seine standhafte Haltung gegenüber dem Tod. Er weicht der Furcht nicht aus, sondern stellt sich der Begegnung und beweist damit seinen Mut und seine Tapferkeit.
Die bildhafte Sprache des Gedichts, insbesondere die Beschreibung der „riesig dunkle Graungestalt“ und die schwere des Todes, tragen zur Verstärkung der beklemmenden Atmosphäre bei. Der Kontrast zwischen dem unerschrockenen Fischer und der düsteren Gestalt des Todes unterstreicht die dramatische Spannung. Die Metapher des Todes als Fährmann, der die Seelen über den Fluss ins Jenseits bringt, ist ein klassisches Motiv, das hier in einer neuen, beunruhigenden Weise interpretiert wird. Die bevorstehende Katastrophe, das Sterben in Gotin, wird durch die Vorhersage des Todes noch weiter angedeutet.
Am Ende offenbart der Tod, dass Elz, aufgrund seines Mutes und seiner Tapferkeit, eine besondere Rolle spielen wird: Er soll später als „sanften Seelenlöser“ den Tod willkommen heißen. Damit wird die Ballade, trotz ihrer düsteren Thematik, nicht nur zu einer Erzählung über den Tod, sondern auch über Mut, Unerschrockenheit und die transzendente Bedeutung des menschlichen Lebens. Die Geschichte des Fischers Elz wird so zu einer Parabel über die Überwindung der Angst und die Akzeptanz des Unvermeidlichen.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
