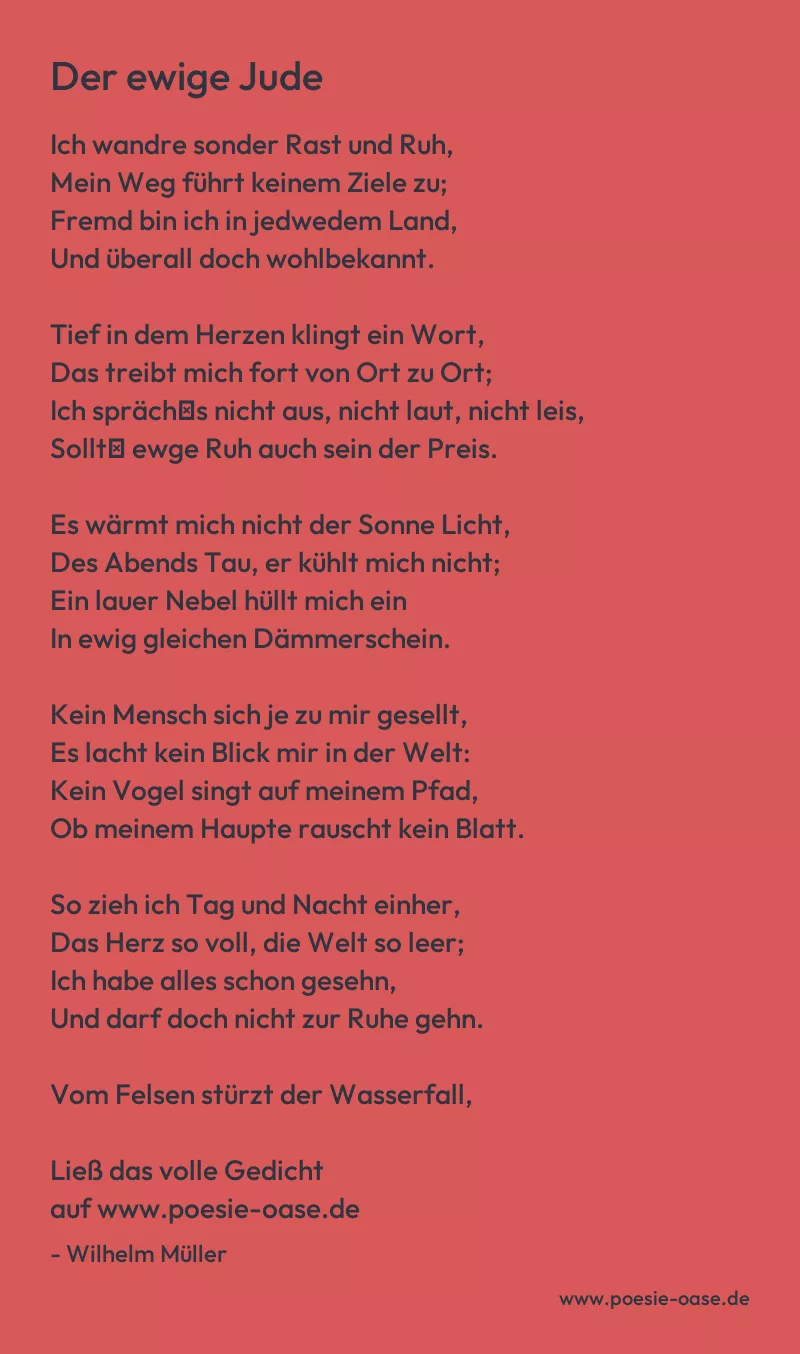Ich wandre sonder Rast und Ruh,
Mein Weg führt keinem Ziele zu;
Fremd bin ich in jedwedem Land,
Und überall doch wohlbekannt.
Tief in dem Herzen klingt ein Wort,
Das treibt mich fort von Ort zu Ort;
Ich spräch′s nicht aus, nicht laut, nicht leis,
Sollt′ ewge Ruh auch sein der Preis.
Es wärmt mich nicht der Sonne Licht,
Des Abends Tau, er kühlt mich nicht;
Ein lauer Nebel hüllt mich ein
In ewig gleichen Dämmerschein.
Kein Mensch sich je zu mir gesellt,
Es lacht kein Blick mir in der Welt:
Kein Vogel singt auf meinem Pfad,
Ob meinem Haupte rauscht kein Blatt.
So zieh ich Tag und Nacht einher,
Das Herz so voll, die Welt so leer;
Ich habe alles schon gesehn,
Und darf doch nicht zur Ruhe gehn.
Vom Felsen stürzt der Wasserfall,
Fort schäumt der Fluß im tiefen Tal;
Er eilt so froh der ewgen Ruh,
Dem stillen Ozeane zu.
Der Adler schwingt sich durch die Luft,
Verschwebend in des Äthers Duft;
Hoch in den Wolken steht sein Haus,
Auf Alpenspitzen ruht er aus.
Der Delphin durch die Fluten schweift,
Wenn in die Bucht der Schiffer läuft;
Und nach dem Sturm im Sonnenschein
Schläft er auf Wellenspiegeln ein.
Die Wolken treiben hin und her,
Sie sind so matt, sie sind so schwer;
Da stürzen rauschend sie herab,
Der Schoß der Erde wird ihr Grab.
Der müde Wandrer dieser Welt,
Ein sicher Ziel ist ihm gestellt.
Was klagt er ob des Tages Not?
Vor Nacht noch holt ihn heim der Tod.
O Mensch, der du den Lauf vollbracht,
Und gehest ein zur kühlen Nacht,
Bet, eh du tust die Augen zu,
Für mich um Stunde Ruh!