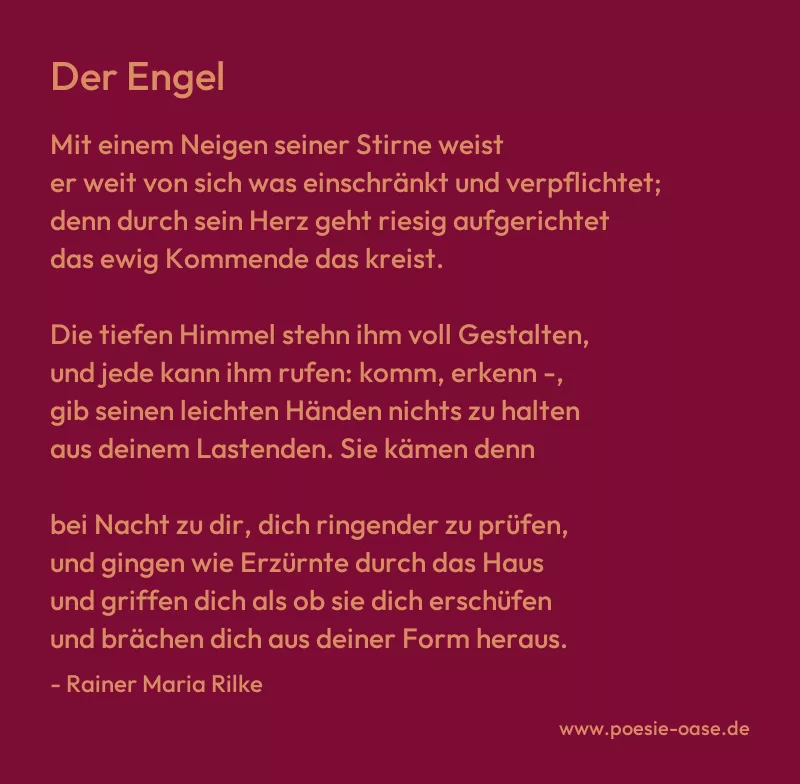Der Engel
Mit einem Neigen seiner Stirne weist
er weit von sich was einschränkt und verpflichtet;
denn durch sein Herz geht riesig aufgerichtet
das ewig Kommende das kreist.
Die tiefen Himmel stehn ihm voll Gestalten,
und jede kann ihm rufen: komm, erkenn -,
gib seinen leichten Händen nichts zu halten
aus deinem Lastenden. Sie kämen denn
bei Nacht zu dir, dich ringender zu prüfen,
und gingen wie Erzürnte durch das Haus
und griffen dich als ob sie dich erschüfen
und brächen dich aus deiner Form heraus.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
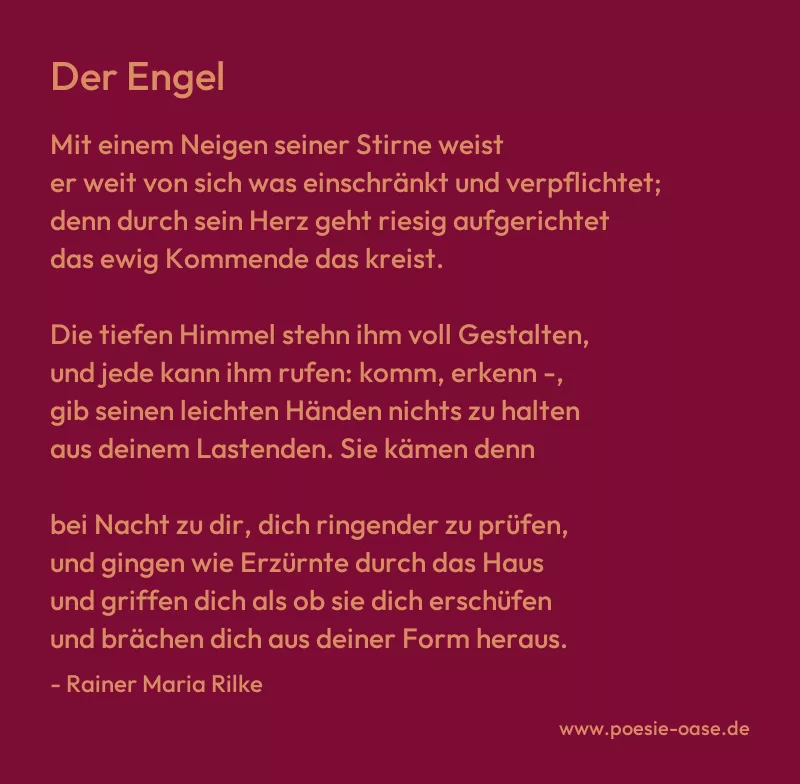
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Engel“ von Rainer Maria Rilke zeichnet das Bild einer entgrenzten, transzendenten Figur, die sich durch ihre Distanz zur irdischen Welt auszeichnet. Der Engel wird als Wesen beschrieben, das sich von allem Abgrenzenden und Verpflichtenden abwendet. Sein Blick, symbolisiert durch das „Neigen seiner Stirne“, weist weit über die irdischen Begrenzungen hinaus und öffnet sich dem „ewig Kommenden“. Dieses ewige Kommen, das durch sein Herz „riesig aufgerichtet“ geht, deutet auf eine innere Weite und eine Verbundenheit mit einer umfassenderen, spirituellen Realität.
Die zweite Strophe vertieft diese Vorstellung der Transzendenz, indem sie den Engel mit dem Himmel und seinen vielfältigen Gestalten in Verbindung bringt. Der „Himmel“ wird hier zum Spiegelbild der Möglichkeiten und des Unbekannten, das den Engel zu ständiger Erkenntnis aufruft. Gleichzeitig wird die Warnung ausgesprochen, irdische Lasten, die „Lastenden“, festzuhalten. Der Engel soll sich von den Zwängen und Begrenzungen der Welt befreien, um sich ganz dem „ewig Kommenden“ zu widmen. Die Betonung der „leichten Händen“ unterstreicht die Freiheit von weltlichen Bindungen.
Die dritte Strophe führt eine bedrohliche Gegenspielerin ein, die vermutlich irdische Kräfte repräsentiert. Diese „Nacht“, die „ringender zu prüfen“ kommt, symbolisiert die Versuchung und die Herausforderung, die auf den Engel einwirken. Die Beschreibung der aggressiven Vorgehensweise, als ob diese Kräfte den Engel „erschüfen“ und „aus seiner Form herausbrechen“ wollen, unterstreicht die Gefahr, die von den irdischen Einflüssen ausgeht. Die „Form“ des Engels steht hier für seine ursprüngliche, reine und transzendente Natur, die durch die weltlichen Kräfte bedroht wird.
Insgesamt ist das Gedicht eine poetische Reflexion über die menschliche Sehnsucht nach Transzendenz und die Schwierigkeiten, die mit der Abwendung von der irdischen Welt verbunden sind. Rilke entwirft das Bild eines Engels, der sich dem Ewigen zuwendet und sich von den Fesseln der Welt befreit. Gleichzeitig warnt er vor den Kräften, die versuchen, diese innere Freiheit zu untergraben und den Menschen in die irdischen Begrenzungen zurückzuzwingen. Das Gedicht kann als Aufforderung zur bewussten Auseinandersetzung mit den eigenen Werten und der Suche nach einer tieferen, spirituellen Erfahrung verstanden werden.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.