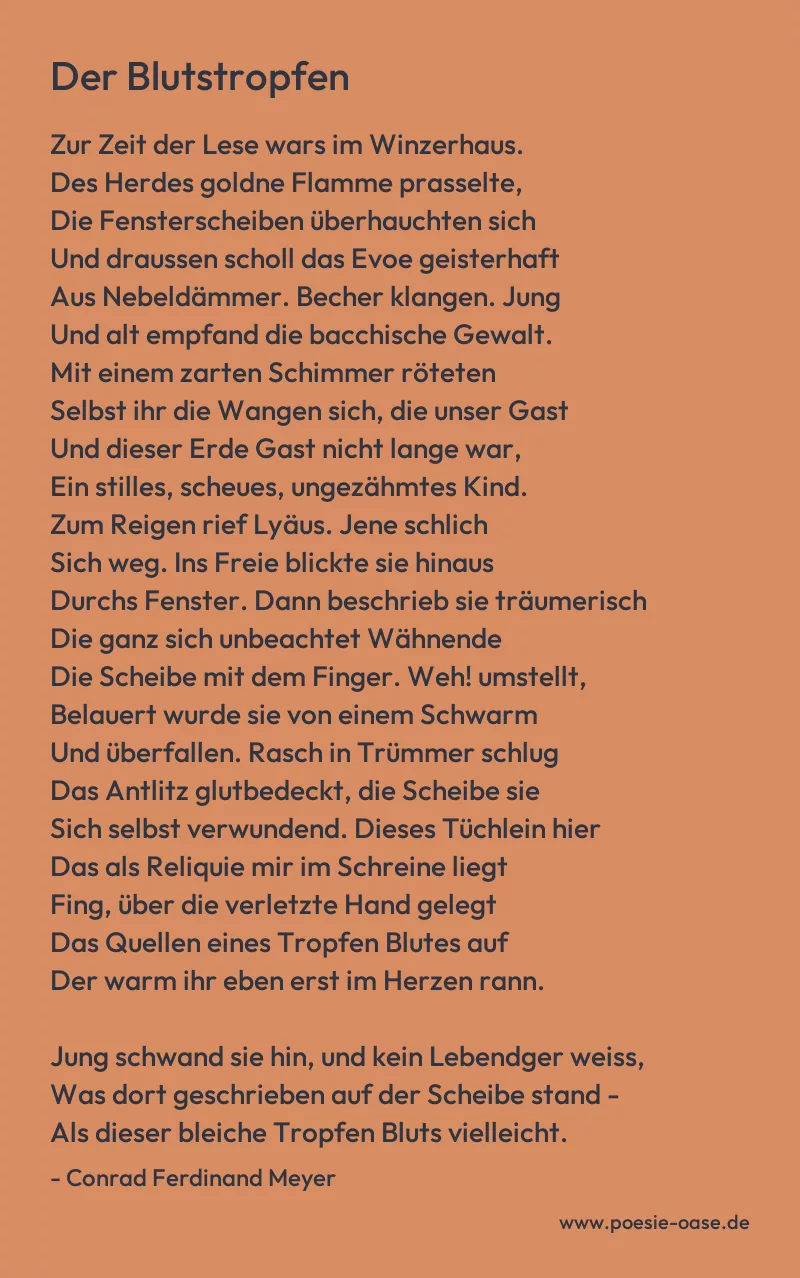Der Blutstropfen
Zur Zeit der Lese wars im Winzerhaus.
Des Herdes goldne Flamme prasselte,
Die Fensterscheiben überhauchten sich
Und draussen scholl das Evoe geisterhaft
Aus Nebeldämmer. Becher klangen. Jung
Und alt empfand die bacchische Gewalt.
Mit einem zarten Schimmer röteten
Selbst ihr die Wangen sich, die unser Gast
Und dieser Erde Gast nicht lange war,
Ein stilles, scheues, ungezähmtes Kind.
Zum Reigen rief Lyäus. Jene schlich
Sich weg. Ins Freie blickte sie hinaus
Durchs Fenster. Dann beschrieb sie träumerisch
Die ganz sich unbeachtet Wähnende
Die Scheibe mit dem Finger. Weh! umstellt,
Belauert wurde sie von einem Schwarm
Und überfallen. Rasch in Trümmer schlug
Das Antlitz glutbedeckt, die Scheibe sie
Sich selbst verwundend. Dieses Tüchlein hier
Das als Reliquie mir im Schreine liegt
Fing, über die verletzte Hand gelegt
Das Quellen eines Tropfen Blutes auf
Der warm ihr eben erst im Herzen rann.
Jung schwand sie hin, und kein Lebendger weiss,
Was dort geschrieben auf der Scheibe stand –
Als dieser bleiche Tropfen Bluts vielleicht.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
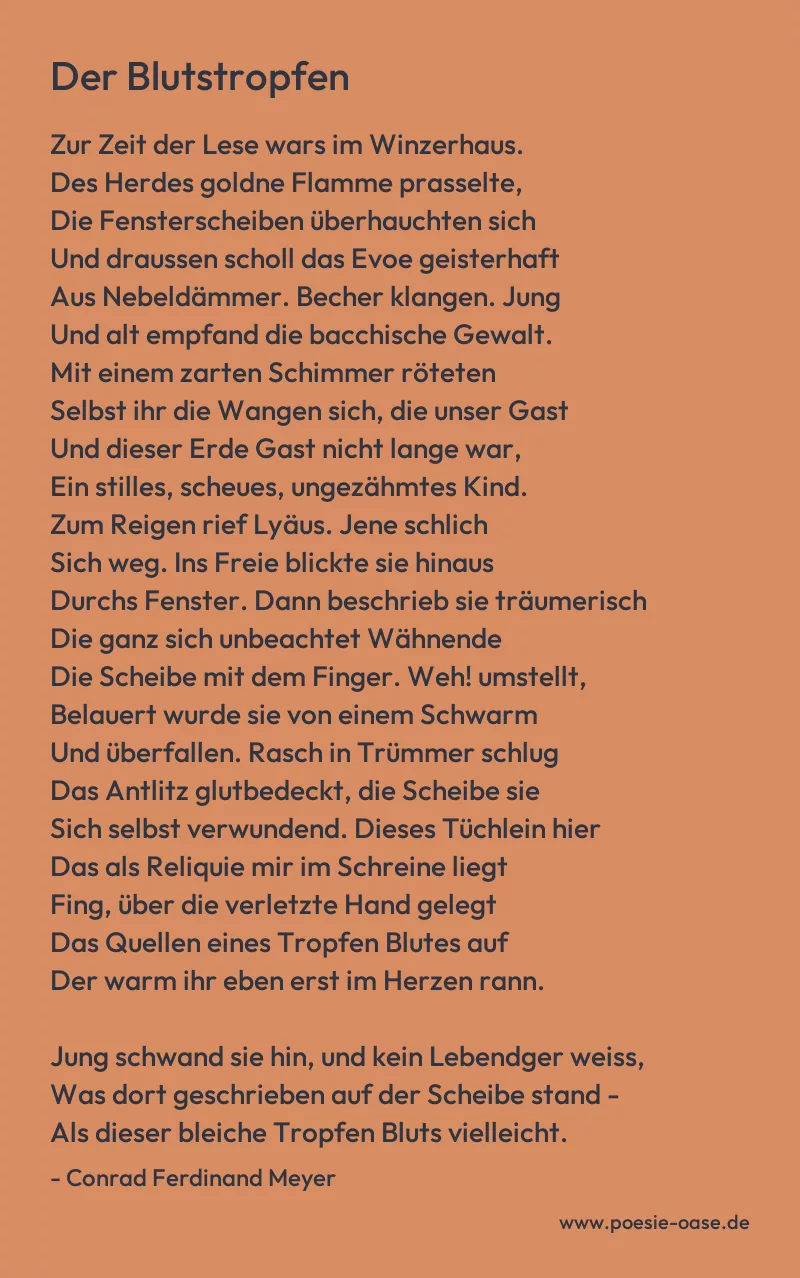
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Der Blutstropfen“ von Conrad Ferdinand Meyer erzählt in düsterer Atmosphäre von einem tragischen Vorfall während der Weinlese. Das Gedicht beginnt mit einer Beschreibung der Szenerie: einem behaglichen Winzerhaus, in dem ein Feuer lodert, während draußen Nebel liegt und Gesänge von Bacchus erklingen. Diese kontrastreichen Elemente – die Wärme des Hauses und die Kälte der Nacht, die Fröhlichkeit der Feier und das Geheimnisvolle draußen – schaffen eine unheimliche Stimmung. Inmitten dieses Festes wird eine junge, scheue Frau porträtiert, die sich vom Geschehen entfernt und durch ein Fenster nach draußen blickt.
Die Handlung verdichtet sich, als die junge Frau auf der beschlagenen Fensterscheibe etwas mit ihrem Finger schreibt. Was sie schreibt, bleibt unklar, aber die anschließenden Verse kündigen eine Katastrophe an. Sie wird von einem „Schwarm“ überfallen und verwundet sich selbst an der Scheibe. Der „Blutstropfen“ im Titel wird somit zum zentralen Element, der die Tragödie symbolisiert. Dieser Tropfen wird von einem weißen Tuch aufgefangen, das zur Reliquie wird, wodurch der Vorfall eine übernatürliche, fast religiöse Qualität erhält.
Das Gedicht verwebt Elemente der Romantik und des Naturalismus. Der Bezug zur antiken Mythologie, der Hinweis auf Bacchus, die Atmosphäre der Weinlese und die dunklen Andeutungen von Geheimnis und Verfolgung sprechen für die romantische Tradition. Gleichzeitig wird die Realität von Blut und Verletzung, die physische und emotionale Verwundbarkeit der jungen Frau thematisiert. Diese Dualität verstärkt die Spannung und die tragische Natur des Ereignisses. Die Frage, was auf der Fensterscheibe geschrieben stand, bleibt offen, doch das Geheimnisvolle und Ungesagte werden zum Kern des Gedichts.
Die zentrale Frage des Gedichts ist die Frage nach dem Geheimnis, das sich in dem Tropfen Blut verbirgt. Der Autor lässt bewusst offen, was die junge Frau auf die Scheibe geschrieben hat und was zu ihrem Ableben geführt hat. Dieser Schwebezustand erzeugt eine beklemmende Atmosphäre und regt die Fantasie des Lesers an. Der Tropfen Blut, der aufgefangen wird, wird zum stummen Zeugen eines Geheimnisses, das für immer in der Vergangenheit verbleibt. Das Gedicht deutet auf eine tragische Geschichte hin, die in der Unkenntnis des Lesers ihre volle Wirkung entfaltet.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.