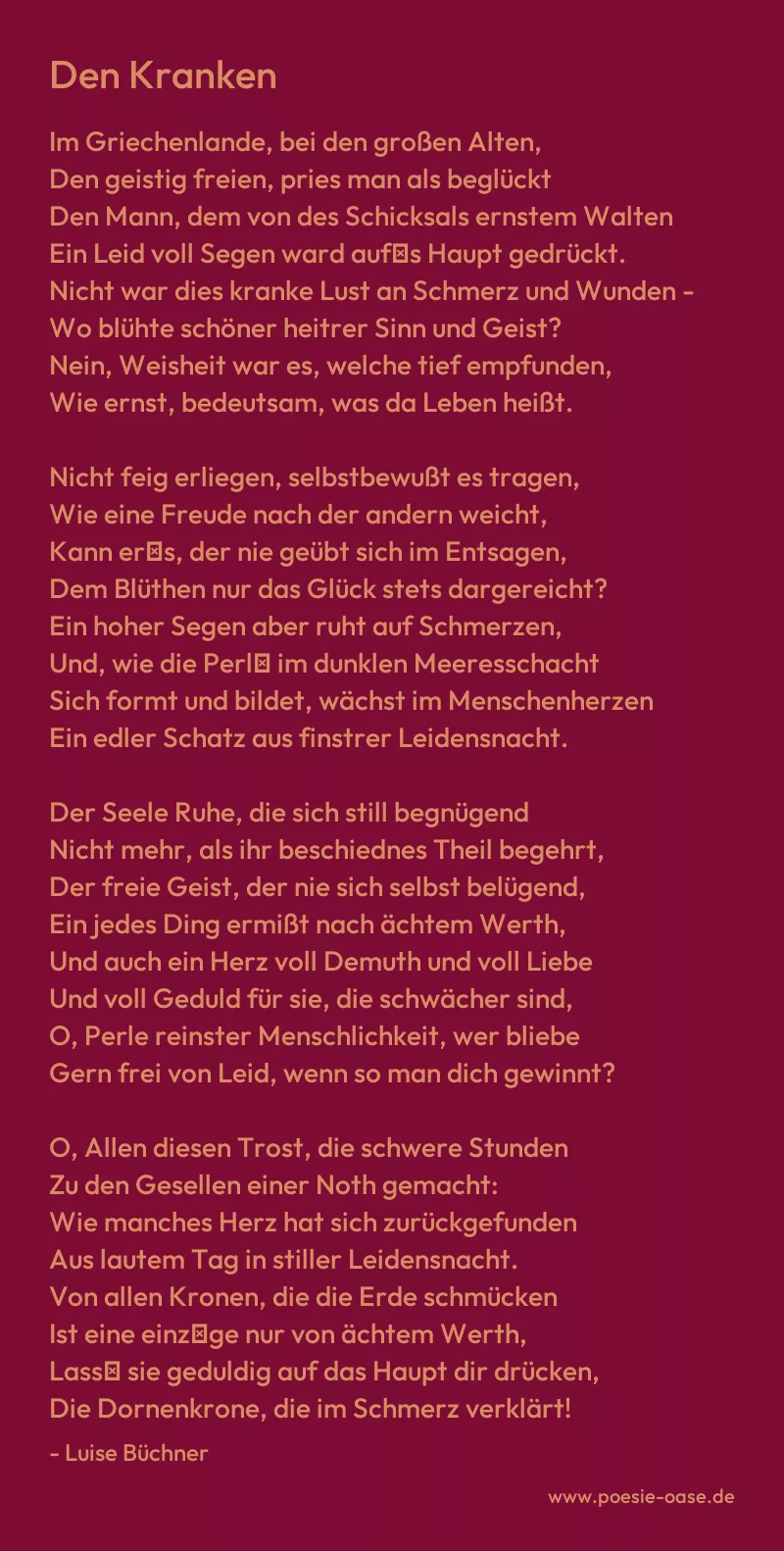Im Griechenlande, bei den großen Alten,
Den geistig freien, pries man als beglückt
Den Mann, dem von des Schicksals ernstem Walten
Ein Leid voll Segen ward auf′s Haupt gedrückt.
Nicht war dies kranke Lust an Schmerz und Wunden –
Wo blühte schöner heitrer Sinn und Geist?
Nein, Weisheit war es, welche tief empfunden,
Wie ernst, bedeutsam, was da Leben heißt.
Nicht feig erliegen, selbstbewußt es tragen,
Wie eine Freude nach der andern weicht,
Kann er′s, der nie geübt sich im Entsagen,
Dem Blüthen nur das Glück stets dargereicht?
Ein hoher Segen aber ruht auf Schmerzen,
Und, wie die Perl′ im dunklen Meeresschacht
Sich formt und bildet, wächst im Menschenherzen
Ein edler Schatz aus finstrer Leidensnacht.
Der Seele Ruhe, die sich still begnügend
Nicht mehr, als ihr beschiednes Theil begehrt,
Der freie Geist, der nie sich selbst belügend,
Ein jedes Ding ermißt nach ächtem Werth,
Und auch ein Herz voll Demuth und voll Liebe
Und voll Geduld für sie, die schwächer sind,
O, Perle reinster Menschlichkeit, wer bliebe
Gern frei von Leid, wenn so man dich gewinnt?
O, Allen diesen Trost, die schwere Stunden
Zu den Gesellen einer Noth gemacht:
Wie manches Herz hat sich zurückgefunden
Aus lautem Tag in stiller Leidensnacht.
Von allen Kronen, die die Erde schmücken
Ist eine einz′ge nur von ächtem Werth,
Lass′ sie geduldig auf das Haupt dir drücken,
Die Dornenkrone, die im Schmerz verklärt!