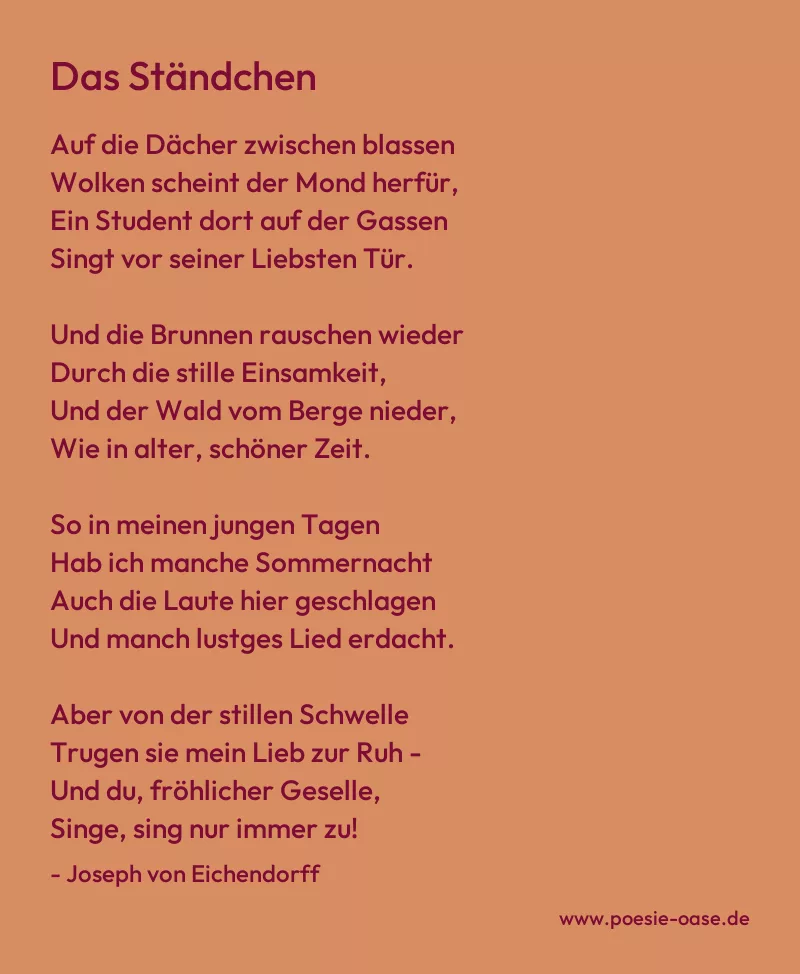Das Ständchen
Auf die Dächer zwischen blassen
Wolken scheint der Mond herfür,
Ein Student dort auf der Gassen
Singt vor seiner Liebsten Tür.
Und die Brunnen rauschen wieder
Durch die stille Einsamkeit,
Und der Wald vom Berge nieder,
Wie in alter, schöner Zeit.
So in meinen jungen Tagen
Hab ich manche Sommernacht
Auch die Laute hier geschlagen
Und manch lustges Lied erdacht.
Aber von der stillen Schwelle
Trugen sie mein Lieb zur Ruh –
Und du, fröhlicher Geselle,
Singe, sing nur immer zu!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
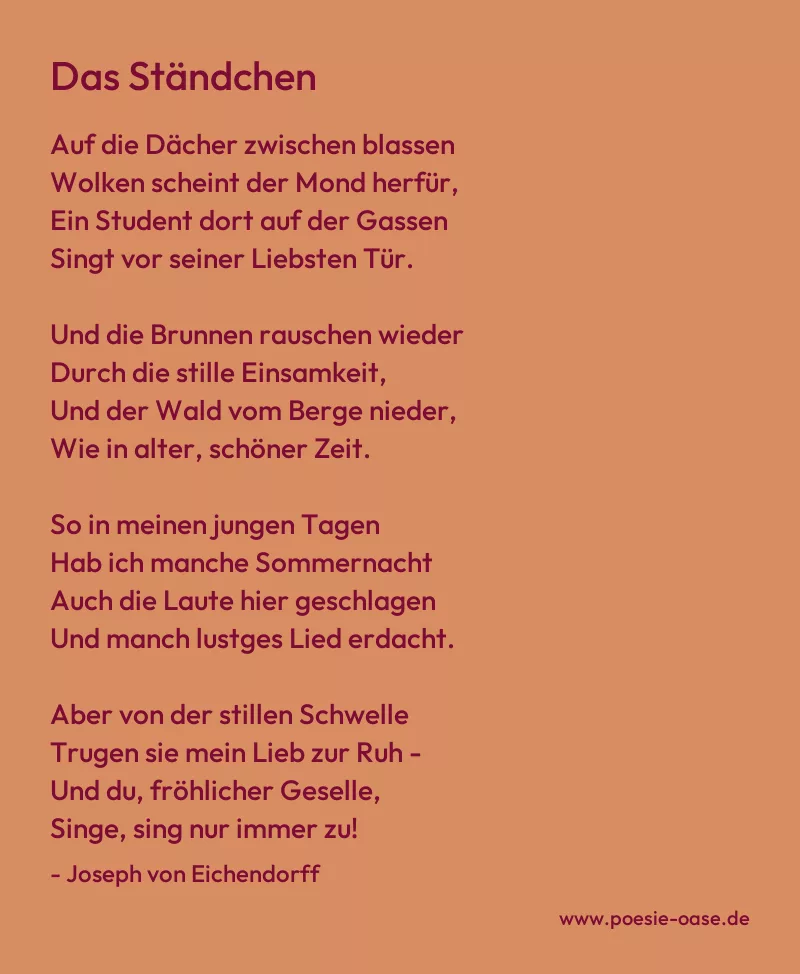
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Ständchen“ von Joseph von Eichendorff ist eine melancholische Betrachtung der Vergangenheit, eingebettet in eine stimmungsvolle Nachtszene. Das lyrische Ich, vermutlich selbst einst Student, lauscht dem Gesang eines jungen Mannes, der seiner Geliebten ein Ständchen darbietet. Die ersten beiden Strophen beschreiben die romantische Szenerie: der Mond, die Wolken, der Brunnen, der Wald – alles trägt zur verträumten Atmosphäre bei, in der das Ständchen des Studenten erklingt.
Die dritte Strophe stellt einen deutlichen Bruch dar. Hier wendet sich das lyrische Ich seiner eigenen Vergangenheit zu und erinnert sich an seine Jugend, in der es ebenfalls Ständchen spielte und fröhliche Lieder sang. Diese Zeilen sind durchzogen von Nostalgie, der Wehmut über vergangene Zeiten und verlorene Liebe. Der Begriff „manche Sommernacht“ suggeriert eine Vielzahl ähnlicher Erlebnisse, die nun in der Erinnerung lebendig werden. Die Laute und die „lustgen Lieder“ stehen dabei für Lebensfreude und Unbeschwertheit.
Die letzte Strophe bringt die Erkenntnis und den Abschied von der eigenen Vergangenheit zum Ausdruck. Die Zeile „Aber von der stillen Schwelle / Trugen sie mein Lieb zur Ruh –“ deutet auf den Tod der einstigen Geliebten hin. Diese Zeilen sind von tiefer Trauer geprägt und zeigen, dass das lyrische Ich die Liebe verloren hat. Die letzten beiden Zeilen sind eine Art Abschiedsformel, in der das lyrische Ich den jungen Studenten ermutigt, weiterzusingen, da er die Liebe und das Leben noch in vollen Zügen genießen kann. Die Zeile „Singe, sing nur immer zu!“ kann als Mischung aus Resignation und Ermutigung verstanden werden.
Eichendorff verwendet eine einfache, volksliedhafte Sprache, die durch sanfte Reime und einen klaren Rhythmus geprägt ist. Die Bilder sind klar und sinnlich, sie sprechen die Vorstellungskraft des Lesers an und erzeugen eine stimmungsvolle Atmosphäre. Die Metaphern wie der Mond, der Brunnen und der Wald sind typisch für die Romantik und tragen zur Vertiefung des Gefühlsgehalts bei. Das Gedicht spiegelt die romantische Sehnsucht nach der Vergangenheit, die Vergänglichkeit des Lebens und die Akzeptanz des Schicksals wider.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.