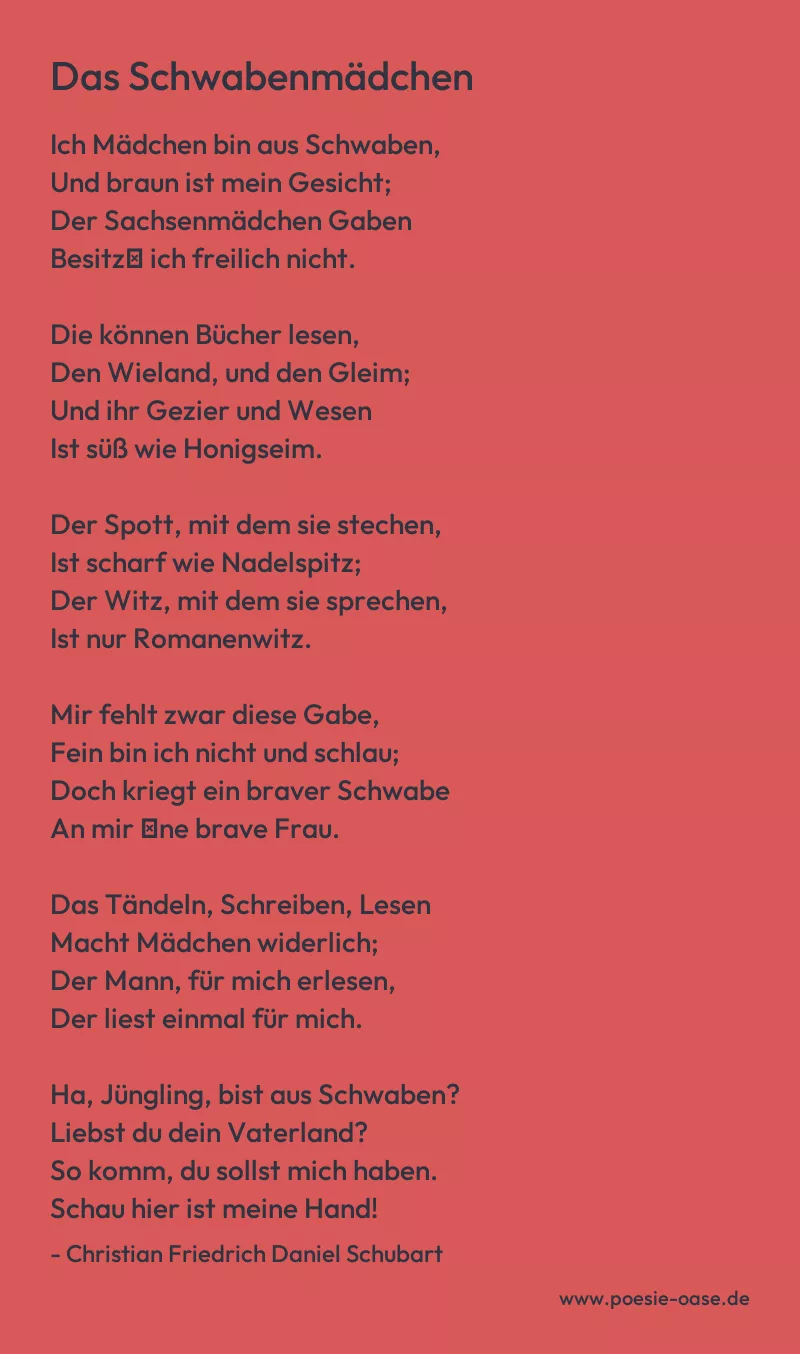Das Schwabenmädchen
Ich Mädchen bin aus Schwaben,
Und braun ist mein Gesicht;
Der Sachsenmädchen Gaben
Besitz′ ich freilich nicht.
Die können Bücher lesen,
Den Wieland, und den Gleim;
Und ihr Gezier und Wesen
Ist süß wie Honigseim.
Der Spott, mit dem sie stechen,
Ist scharf wie Nadelspitz;
Der Witz, mit dem sie sprechen,
Ist nur Romanenwitz.
Mir fehlt zwar diese Gabe,
Fein bin ich nicht und schlau;
Doch kriegt ein braver Schwabe
An mir ′ne brave Frau.
Das Tändeln, Schreiben, Lesen
Macht Mädchen widerlich;
Der Mann, für mich erlesen,
Der liest einmal für mich.
Ha, Jüngling, bist aus Schwaben?
Liebst du dein Vaterland?
So komm, du sollst mich haben.
Schau hier ist meine Hand!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
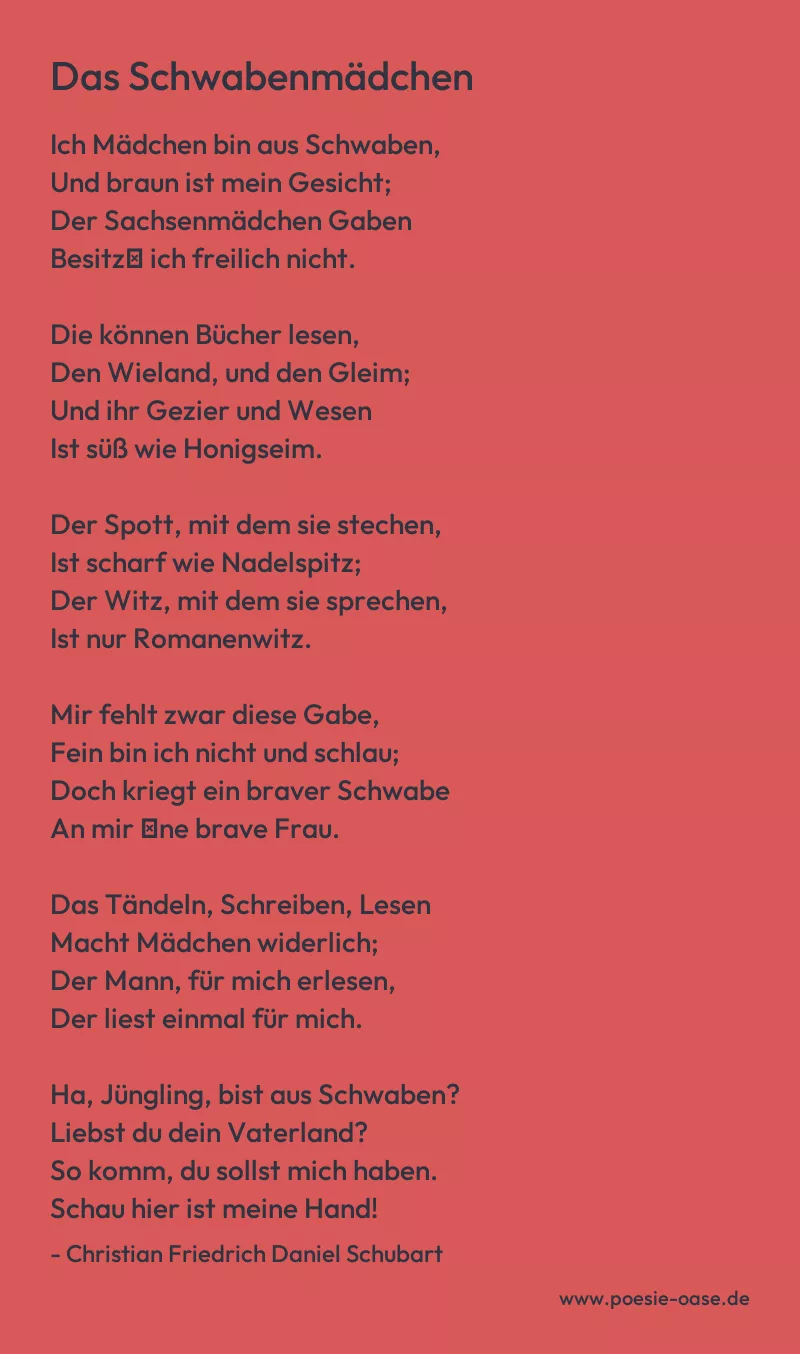
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Schwabenmädchen“ von Christian Friedrich Daniel Schubart ist ein humorvolles und selbstbewusstes Bekenntnis der einfachen Tugenden und Vorzüge eines schwäbischen Mädchens im Kontrast zu den vermeintlich gelehrteren und kultivierteren sächsischen Frauen. Schubart stellt hier die vermeintliche Oberflächlichkeit der sächsischen Mädchen, die Bücher lesen und sich in feiner Gesellschaft bewegen, der bodenständigen Ehrlichkeit und Tüchtigkeit der Schwäbin gegenüber.
Das Gedicht beginnt mit einer Selbstbeschreibung: Die Protagonistin ist ein schwäbisches Mädchen mit braunem Gesicht, das sich der fehlenden „Gaben“ der sächsischen Mädchen bewusst ist. Diese „Gaben“ werden im zweiten und dritten Verspaar näher ausgeführt: Bildung, die Fähigkeit, Dichter wie Wieland und Gleim zu lesen, sowie ein süßes Wesen. Allerdings wird diese „Süße“ mit Spott und Romanenwitz kontrastiert, was die vermeintliche Oberflächlichkeit und Unehrlichkeit der Sachsenmädchen unterstreicht. Die rhetorische Frage im ersten Vers suggeriert bereits, dass die Autorin die Vorzüge der sächsischen Frauen nicht als erstrebenswert empfindet.
Die folgenden Strophen entwerfen ein positives Bild der Schwäbin. Obwohl ihr Bildung und Raffinesse fehlen, wird sie als „brave Frau“ für einen „braven Schwaben“ gelobt. Schubart greift hier ein traditionelles Rollenbild auf, in dem die Frau Hausfrau und Mutter ist, während der Mann die geistige Arbeit übernimmt. Die ironische Spitze gegen das „Tändeln, Schreiben, Lesen“ unterstreicht die Ablehnung der modernen, intellektuellen Frauenrolle, die im Gegensatz zur traditionellen, häuslichen Rolle der Schwäbin steht. Der Satz „Der Mann, für mich erlesen, / Der liest einmal für mich“ verdeutlicht die klare Rollenverteilung und die pragmatische Natur der Schwäbin.
Das Gedicht endet mit einer direkten Ansprache an einen schwäbischen Jüngling, die die Selbstsicherheit und das Selbstverständnis der Protagonistin unterstreicht. Die Aufforderung, sie zu heiraten, sowie die angebotene Hand, symbolisieren ihre Bereitschaft zur Heirat und ihre Verankerung in der Heimat. Schubarts Gedicht ist somit eine humorvolle Verteidigung der schlichten, traditionellen Werte gegenüber der modischen, gelehrten Welt. Es ist ein Bekenntnis zur Heimatliebe, zur Einfachheit und zur Ehrlichkeit der schwäbischen Kultur, verpackt in einem eingängigen, volkstümlichen Stil.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.