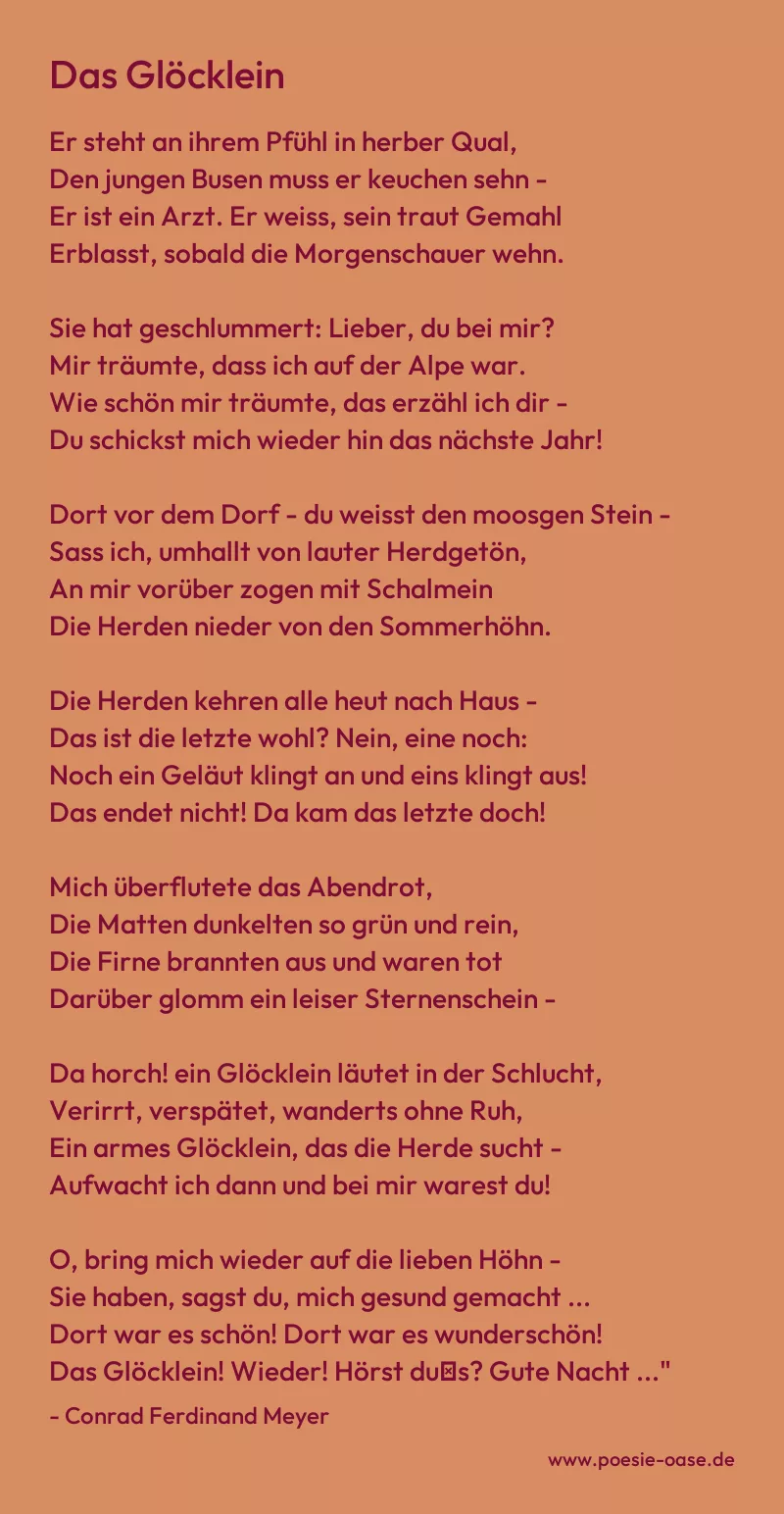Er steht an ihrem Pfühl in herber Qual,
Den jungen Busen muss er keuchen sehn –
Er ist ein Arzt. Er weiss, sein traut Gemahl
Erblasst, sobald die Morgenschauer wehn.
Sie hat geschlummert: Lieber, du bei mir?
Mir träumte, dass ich auf der Alpe war.
Wie schön mir träumte, das erzähl ich dir –
Du schickst mich wieder hin das nächste Jahr!
Dort vor dem Dorf – du weisst den moosgen Stein –
Sass ich, umhallt von lauter Herdgetön,
An mir vorüber zogen mit Schalmein
Die Herden nieder von den Sommerhöhn.
Die Herden kehren alle heut nach Haus –
Das ist die letzte wohl? Nein, eine noch:
Noch ein Geläut klingt an und eins klingt aus!
Das endet nicht! Da kam das letzte doch!
Mich überflutete das Abendrot,
Die Matten dunkelten so grün und rein,
Die Firne brannten aus und waren tot
Darüber glomm ein leiser Sternenschein –
Da horch! ein Glöcklein läutet in der Schlucht,
Verirrt, verspätet, wanderts ohne Ruh,
Ein armes Glöcklein, das die Herde sucht –
Aufwacht ich dann und bei mir warest du!
O, bring mich wieder auf die lieben Höhn –
Sie haben, sagst du, mich gesund gemacht …
Dort war es schön! Dort war es wunderschön!
Das Glöcklein! Wieder! Hörst du′s? Gute Nacht …“