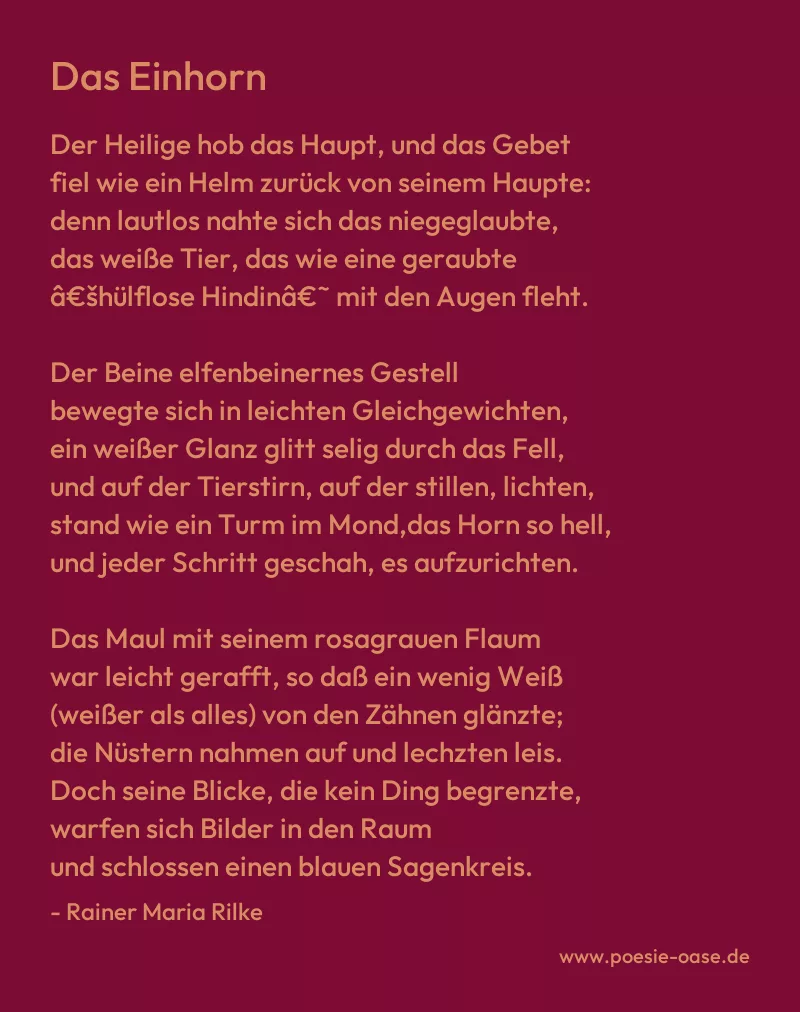Das Einhorn
Der Heilige hob das Haupt, und das Gebet
fiel wie ein Helm zurück von seinem Haupte:
denn lautlos nahte sich das niegeglaubte,
das weiße Tier, das wie eine geraubte
‚hülflose Hindin‘ mit den Augen fleht.
Der Beine elfenbeinernes Gestell
bewegte sich in leichten Gleichgewichten,
ein weißer Glanz glitt selig durch das Fell,
und auf der Tierstirn, auf der stillen, lichten,
stand wie ein Turm im Mond,das Horn so hell,
und jeder Schritt geschah, es aufzurichten.
Das Maul mit seinem rosagrauen Flaum
war leicht gerafft, so daß ein wenig Weiß
(weißer als alles) von den Zähnen glänzte;
die Nüstern nahmen auf und lechzten leis.
Doch seine Blicke, die kein Ding begrenzte,
warfen sich Bilder in den Raum
und schlossen einen blauen Sagenkreis.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
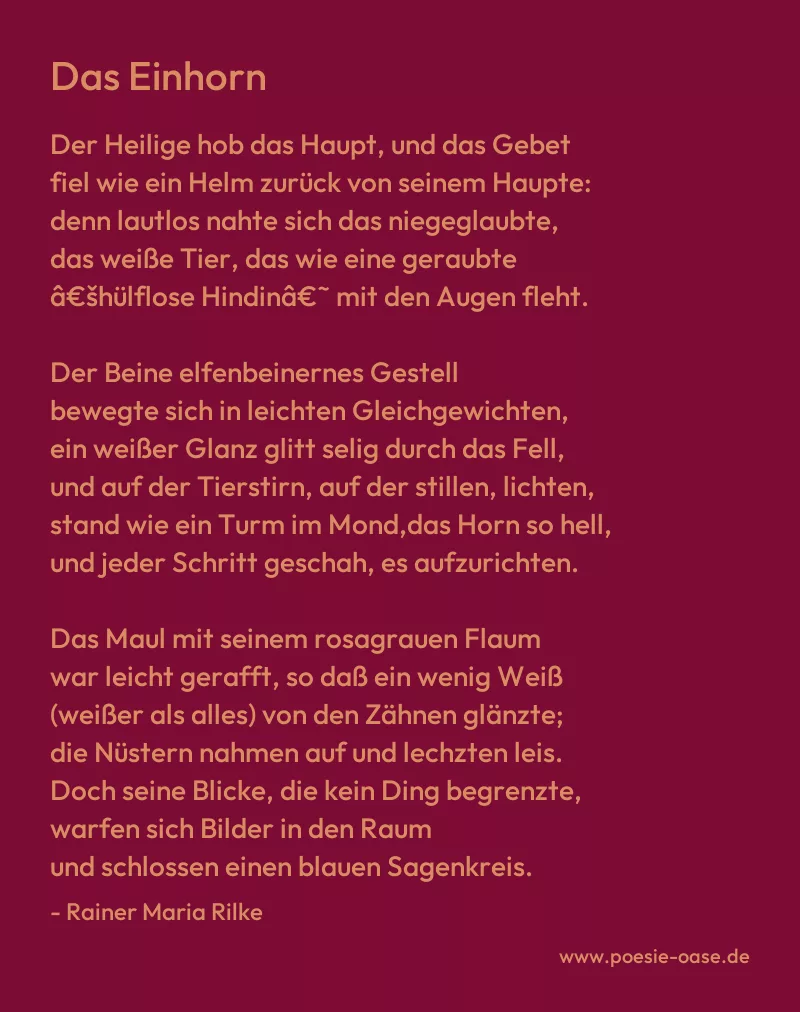
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Das Einhorn“ von Rainer Maria Rilke ist eine poetische Beschreibung des Einhorns, einer mythologischen Kreatur, die oft mit Reinheit, Unschuld und spiritueller Bedeutung assoziiert wird. Das Gedicht ist in drei Strophen unterteilt, die jeweils verschiedene Aspekte des Einhorns hervorheben und dessen Aura des Geheimnisvollen und Göttlichen unterstreichen. Rilke verwendet eine detaillierte und bildhafte Sprache, um die Erscheinung des Einhorns zu beschreiben und seine Verbindung zu einer spirituellen Welt anzudeuten.
In der ersten Strophe wird die Reaktion eines „Heiligen“ auf die Ankunft des Einhorns beschrieben. Die Zeile „der Heilige hob das Haupt, und das Gebet / fiel wie ein Helm zurück von seinem Haupte“ deutet auf einen Moment der Ehrfurcht und Überraschung hin, als der Heilige von der Anwesenheit des Einhorns überwältigt wird. Das Einhorn wird als „niegeglaubte, / das weiße Tier“ bezeichnet, was seine mythische Natur und seine Seltenheit betont. Der Vergleich mit einer „hülflose[n] Hindin“ in den Augen des Einhorns verleiht der Kreatur eine gewisse Verletzlichkeit und fordert die Lesenden*en auf, Mitleid zu empfinden, was im starken Kontrast zu der klassischen Darstellung des Einhorns als majestätisch und stark steht.
Die zweite Strophe konzentriert sich auf die physische Erscheinung des Einhorns. Rilke beschreibt detailliert das „elfenbeinernes Gestell“ seiner Beine, den „weißen Glanz“ im Fell und das „Horn so hell“ auf seiner Stirn, das wie ein „Turm im Mond“ erscheint. Die Beschreibung der Bewegung des Einhorns, „und jeder Schritt geschah, es aufzurichten“, erweckt den Eindruck von Anmut und Würde. Die Verwendung von Adjektiven wie „stillen, lichten“ und „selig“ verstärkt die Aura der Heiligkeit und des Friedens, die das Einhorn umgibt.
Die dritte Strophe widmet sich dem Ausdruck und der Symbolik des Einhorns. Das Maul mit dem „rosagrauen Flaum“ und den „glänzenden“ Zähnen ist in einer subtilen Art beschrieben, wobei die Aufmerksamkeit auf die Blicke des Einhorns gelenkt wird. Die Augen, die „kein Ding begrenzte“, werfen „Bilder in den Raum“ und schließen „einen blauen Sagenkreis“. Dieser Satz deutet auf die Fähigkeit des Einhorns hin, die Realität zu transzendieren und eine Verbindung zu einer Welt der Mythen und Sagen herzustellen. Das Gedicht endet mit einem Gefühl der Geheimnis, was die Fähigkeit des Einhorns, das Unbekannte zu verkörpern, unterstreicht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.