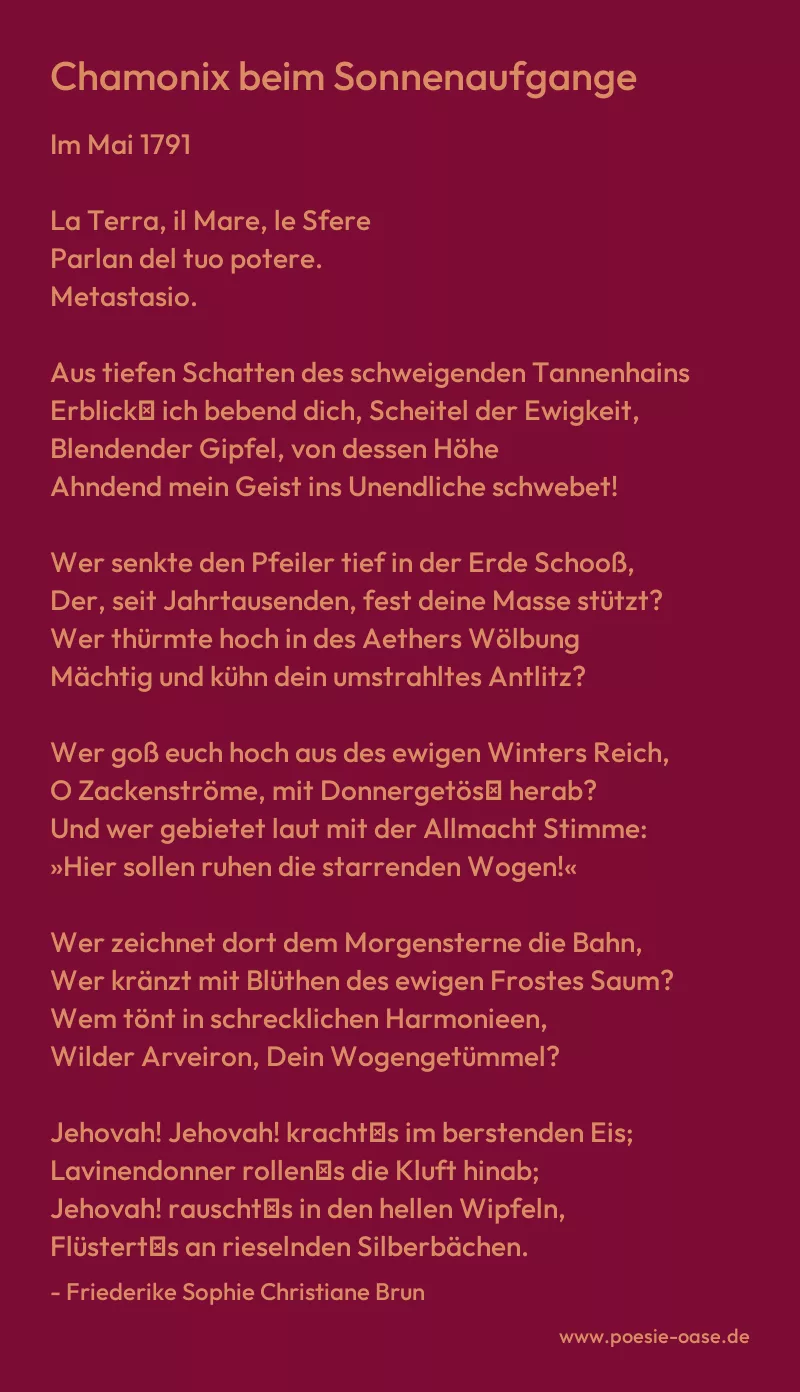Chamonix beim Sonnenaufgange
Im Mai 1791
La Terra, il Mare, le Sfere
Parlan del tuo potere.
Metastasio.
Aus tiefen Schatten des schweigenden Tannenhains
Erblick′ ich bebend dich, Scheitel der Ewigkeit,
Blendender Gipfel, von dessen Höhe
Ahndend mein Geist ins Unendliche schwebet!
Wer senkte den Pfeiler tief in der Erde Schooß,
Der, seit Jahrtausenden, fest deine Masse stützt?
Wer thürmte hoch in des Aethers Wölbung
Mächtig und kühn dein umstrahltes Antlitz?
Wer goß euch hoch aus des ewigen Winters Reich,
O Zackenströme, mit Donnergetös′ herab?
Und wer gebietet laut mit der Allmacht Stimme:
»Hier sollen ruhen die starrenden Wogen!«
Wer zeichnet dort dem Morgensterne die Bahn,
Wer kränzt mit Blüthen des ewigen Frostes Saum?
Wem tönt in schrecklichen Harmonieen,
Wilder Arveiron, Dein Wogengetümmel?
Jehovah! Jehovah! kracht′s im berstenden Eis;
Lavinendonner rollen′s die Kluft hinab;
Jehovah! rauscht′s in den hellen Wipfeln,
Flüstert′s an rieselnden Silberbächen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
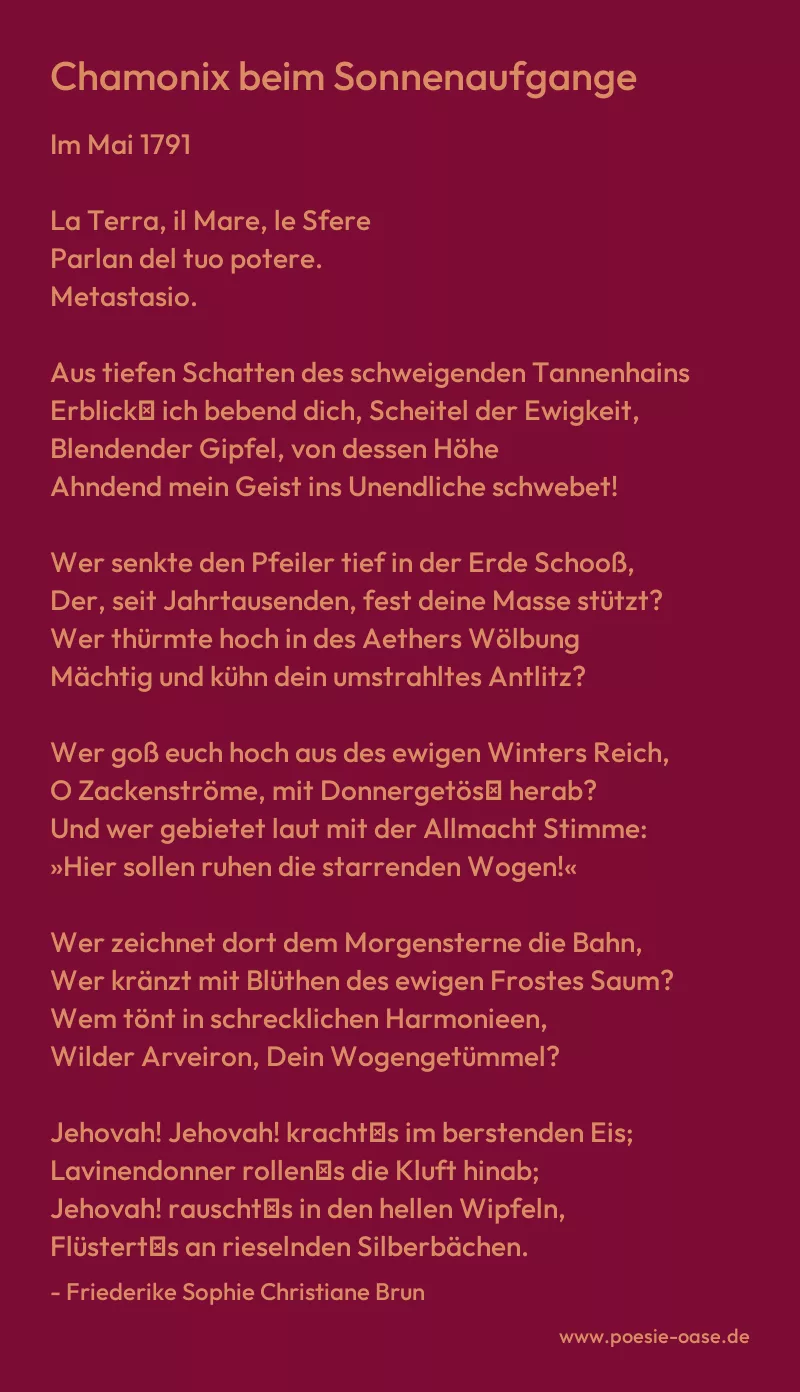
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Chamonix beim Sonnenaufgange“ von Friederike Sophie Christiane Brun ist eine eindringliche Hymne auf die Ehrfurcht vor der Natur und eine direkte Anrufung Gottes. Es beginnt mit dem poetischen Zitat von Metastasio, das die Macht Gottes durch die Erde, das Meer und die Sterne preist, und etabliert so den thematischen Rahmen des Gedichts: die Beobachtung der Natur als Manifestation des Göttlichen. Die Autorin beschreibt, wie sie, aus den „tiefen Schatten des schweigenden Tannenhains“ kommend, den majestätischen Gipfel von Chamonix im Morgengrauen erblickt. Dieses Bild dient als Ausgangspunkt für eine Reihe rhetorischer Fragen, die die Erhabenheit der Schöpfung und die Macht Gottes hervorheben.
Die Fragen, die im Verlauf des Gedichts gestellt werden, sind nicht nur rein rhetorischer Natur; sie laden den Leser ein, über die Ursprünge und die Ordnung der Natur nachzudenken. Wer den Berg so fest in der Erde verankerte, wer die Gipfel in den Himmel erhob, wer die Gletscher zum Fließen brachte – all diese Fragen weisen auf einen Schöpfer hin, der mit unendlicher Macht und Weisheit agiert. Die Beschreibungen sind voller Ehrfurcht und Staunen, was durch die Verwendung von Superlativen wie „blendender Gipfel“, „ewiger Winter“ und „rieselnden Silberbächen“ zusätzlich betont wird. Die Naturerscheinungen, wie das „Donnergetös'“ der Zackenströme oder das Getümmel des Arveiron, werden zu Zeugnissen der göttlichen Allmacht.
Der Höhepunkt des Gedichts ist die direkte Anrufung „Jehovah!“. Dieser Ruf, der sich wie ein Echo durch das gesamte Gedicht zieht, wird von den natürlichen Elementen wie Eis, Lawinen und den Baumwipfeln widergespiegelt. Die Verwendung des Gottesnamens in Verbindung mit Naturgewalten verleiht dem Gedicht eine ergreifende religiöse Tiefe. Brun verdeutlicht, dass die Natur selbst die Stimme Gottes ist, der sich in den Erscheinungen der Schöpfung offenbart. Das Gedicht ist somit nicht nur eine Beschreibung der Natur, sondern auch eine religiöse Meditation über das Göttliche und seine Präsenz in der Welt.
Die Sprache des Gedichts ist feierlich und erhaben. Die Verwendung von altertümlichen Wörtern und Ausdrücken, wie „Schooß“, „thürmte“ und „getös’“, unterstreicht die feierliche Atmosphäre. Der Wechsel von direkten Beschreibungen zu rhetorischen Fragen erzeugt eine dynamische Spannung und hält die Aufmerksamkeit des Lesers. Die Wahl des Stils und der Themen spiegelt das Verständnis der Autorin für die Natur, die sie als Quelle der Inspiration und der Offenbarung des Göttlichen betrachtet, wider. Das Gedicht ist somit ein Bekenntnis zu einer Weltanschauung, in der Natur und Religion untrennbar miteinander verbunden sind.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.