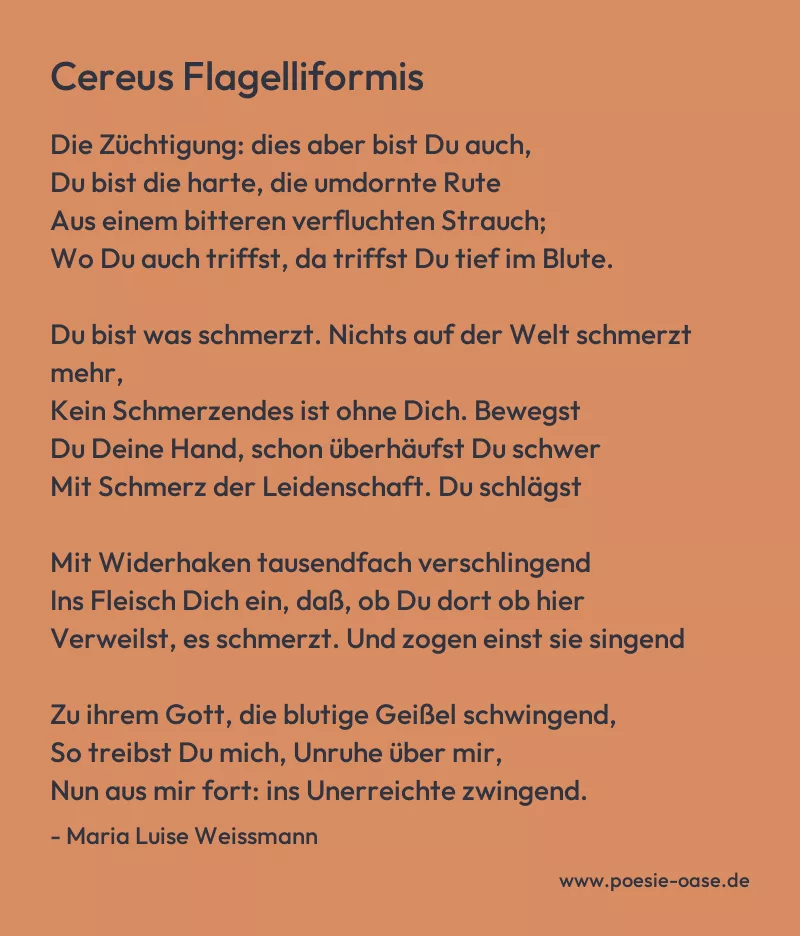Cereus Flagelliformis
Die Züchtigung: dies aber bist Du auch,
Du bist die harte, die umdornte Rute
Aus einem bitteren verfluchten Strauch;
Wo Du auch triffst, da triffst Du tief im Blute.
Du bist was schmerzt. Nichts auf der Welt schmerzt mehr,
Kein Schmerzendes ist ohne Dich. Bewegst
Du Deine Hand, schon überhäufst Du schwer
Mit Schmerz der Leidenschaft. Du schlägst
Mit Widerhaken tausendfach verschlingend
Ins Fleisch Dich ein, daß, ob Du dort ob hier
Verweilst, es schmerzt. Und zogen einst sie singend
Zu ihrem Gott, die blutige Geißel schwingend,
So treibst Du mich, Unruhe über mir,
Nun aus mir fort: ins Unerreichte zwingend.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
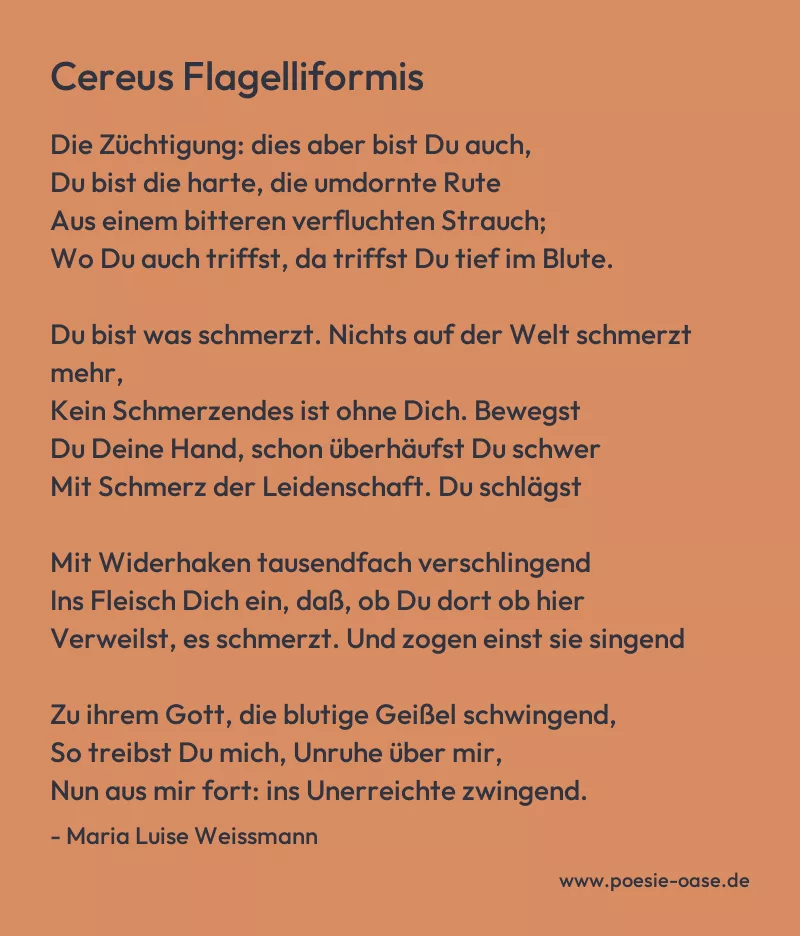
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Cereus Flagelliformis“ von Maria Luise Weissmann ist eine düstere Auseinandersetzung mit dem Thema der Pein und der Selbstzerstörung, dargestellt durch eine Metapher der Züchtigung. Der Titel, der den wissenschaftlichen Namen einer Kaktusart (Geißelkaktus) aufgreift, deutet auf die stachelige Natur der erlebten Qual hin, die im Gedicht als die „harte, umdornte Rute“ beschrieben wird. Diese „Rute“ steht für einen inneren oder äußeren Zwang, der Schmerz verursacht und den Menschen in einen Zustand der Unruhe und des Leidens versetzt.
Der zweite Abschnitt vertieft diese Metapher, indem er die Natur des Schmerzes und seine Allgegenwärtigkeit betont. Weissmann beschreibt, wie der Schmerz untrennbar mit der menschlichen Existenz verbunden ist und alles, was sie berührt, mit Leid erfüllt. Die „Widerhaken tausendfach verschlingend“ verdeutlichen die Intensität und das festhaltende Wesen des Schmerzes, das sich tief im Fleisch verankert und unabhängig von der räumlichen oder zeitlichen Situation anhält. Das Gedicht suggeriert somit eine qualvolle Erfahrung, der man nicht entrinnen kann und die sich auf jede Facette des Lebens auswirkt.
Der letzte Abschnitt führt eine interessante Parallele zur religiösen Praxis ein, indem er die blutige Geißel der Gläubigen erwähnt, die einst zu ihrem Gott sangen. Diese Referenz verknüpft die im Gedicht beschriebene Qual mit einem religiösen Kontext, deutet aber auch auf die Widersprüchlichkeit hin, da die „Unruhe“ nun als treibende Kraft wirkt, die den Ich-Erzähler „aus mir fort: ins Unerreichte zwingend“. Dieser Zwang ist nicht mit Erhebung oder Erlösung verbunden, sondern mit einem unaufhaltsamen Drang, in eine unerreichbare Leere getrieben zu werden, was die Perspektive der Hoffnungslosigkeit und der Isolation verstärkt.
Insgesamt ist das Gedicht eine eindringliche Reflexion über die Schmerzhaftigkeit des menschlichen Daseins und die zerstörerische Kraft innerer oder äußerer Zwänge. Weissmann verwendet eine kraftvolle Bildsprache, um die Intensität des Leidens zu erfassen und eine Atmosphäre der Verzweiflung zu erzeugen. Die Metapher der Züchtigung, verbunden mit der religiösen Anspielung, verstärkt die Beklemmung und suggeriert, dass das Leiden eine grundlegende und vielleicht sogar unvermeidliche Komponente des Lebens ist.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.