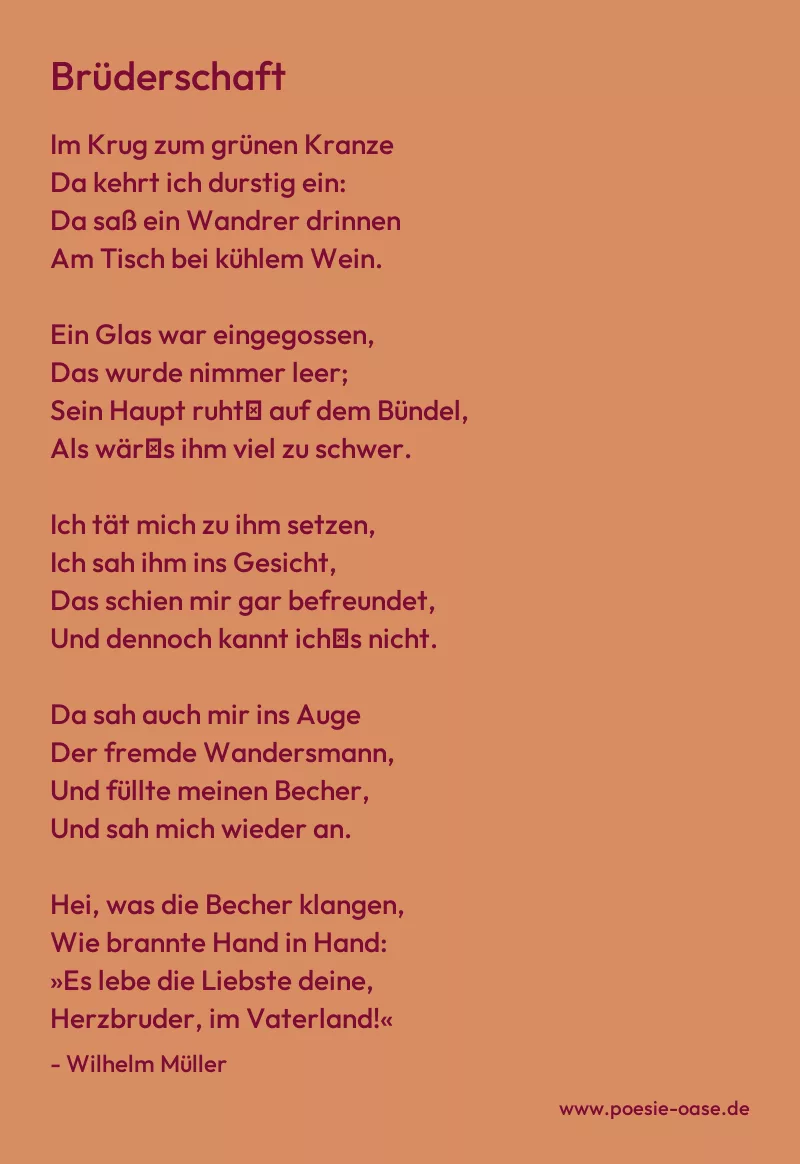Brüderschaft
Im Krug zum grünen Kranze
Da kehrt ich durstig ein:
Da saß ein Wandrer drinnen
Am Tisch bei kühlem Wein.
Ein Glas war eingegossen,
Das wurde nimmer leer;
Sein Haupt ruht′ auf dem Bündel,
Als wär′s ihm viel zu schwer.
Ich tät mich zu ihm setzen,
Ich sah ihm ins Gesicht,
Das schien mir gar befreundet,
Und dennoch kannt ich′s nicht.
Da sah auch mir ins Auge
Der fremde Wandersmann,
Und füllte meinen Becher,
Und sah mich wieder an.
Hei, was die Becher klangen,
Wie brannte Hand in Hand:
»Es lebe die Liebste deine,
Herzbruder, im Vaterland!«
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
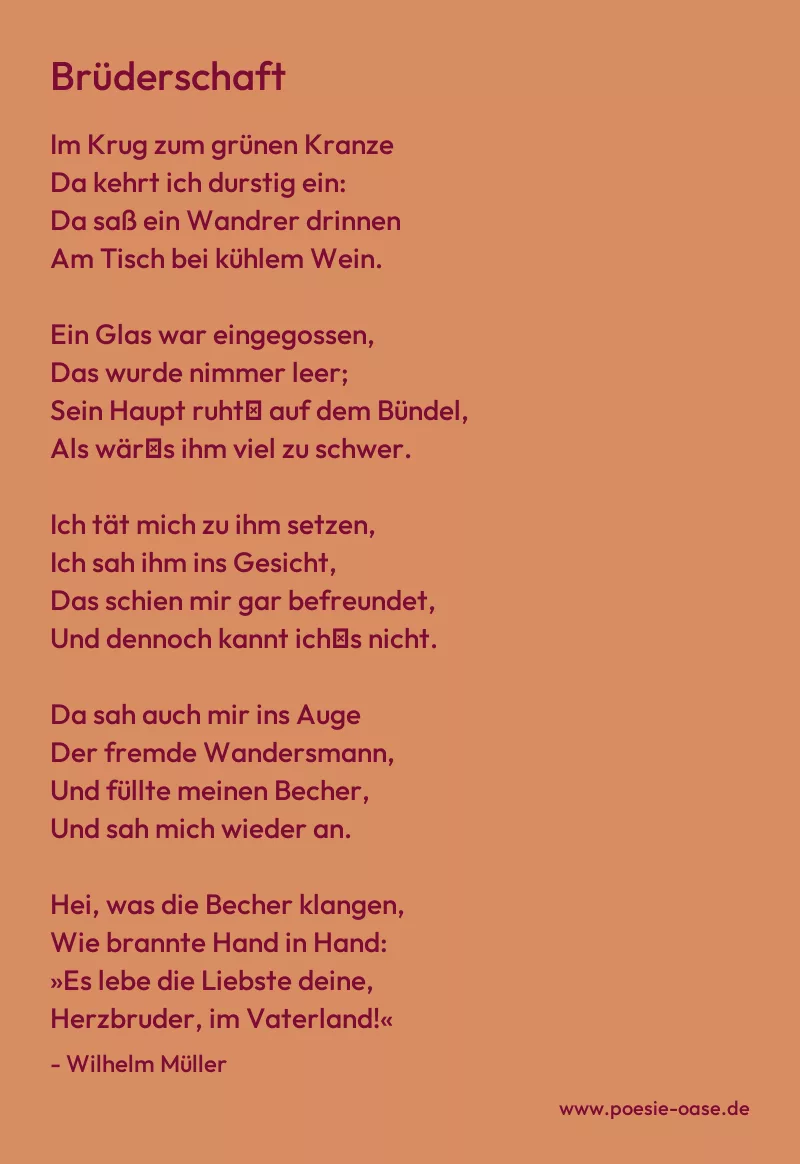
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Brüderschaft“ von Wilhelm Müller beschreibt eine innige Begegnung zweier Wanderer in einer Gaststätte. Die Atmosphäre ist von einer tiefen Verbundenheit und einem Gefühl der Vertrautheit geprägt, obwohl die beiden Männer einander fremd sind. Das Gedicht beginnt mit der einfachen Handlung des Einkehrhaltens in einem Gasthaus, wodurch sofort eine entspannte, alltägliche Szene etabliert wird. Das Bild des durstigen Erzählers und des ruhenden Wanderers am Tisch erzeugt eine gewisse Spannung, die durch die folgenden Verse aufgelöst wird.
Die zweite Strophe verstärkt die stille Beobachtung des Erzählers. Der fremde Wanderer, der sein Haupt auf seinem Bündel ruhen lässt, scheint von einer tiefen Müdigkeit oder Schwere erfasst zu sein. Das „nimmer leere“ Glas des Weins und die Metapher des schweren Hauptes deuten auf eine bereits bestehende Verbundenheit und das Gefühl des Trostes, das im Wein gefunden wird. Der Erzähler, getrieben von Neugier und Sympathie, sucht die Nähe des Fremden und versucht, sein Gesicht zu deuten. Dieses Gefühl der Vertrautheit, die trotz der Fremdheit empfunden wird, ist ein zentrales Thema des Gedichts.
Der Wendepunkt des Gedichts liegt in der vierten Strophe, als der fremde Wanderer den Erzähler ansieht und dessen Becher füllt. Der Blickkontakt und das gemeinsame Trinken markieren den Beginn einer brüderlichen Verbindung. Die folgende Zeile „Hei, was die Becher klangen“ verdeutlicht das Aufbrechen der Stille und die Freude über die plötzliche, tiefe Verbundenheit, die durch das gemeinsame Trinken und den Austausch entsteht.
In der letzten Strophe kulminiert diese Verbundenheit in einem Trinkspruch auf die „Liebste“ des Erzählers im Vaterland. Die Worte „Herzbruder“ und „Hand in Hand“ drücken das Gefühl der Freundschaft, der Brüderschaft und des gegenseitigen Verständnisses aus. Das Gedicht feiert die spontane Entstehung von Freundschaft zwischen Fremden und thematisiert das Gefühl der Verbundenheit, das in Momenten des Teilens und der Empathie entstehen kann. Es ist ein Loblied auf die menschliche Wärme und die Fähigkeit, trotz aller Unterschiede eine tiefe Verbindung zu spüren.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.