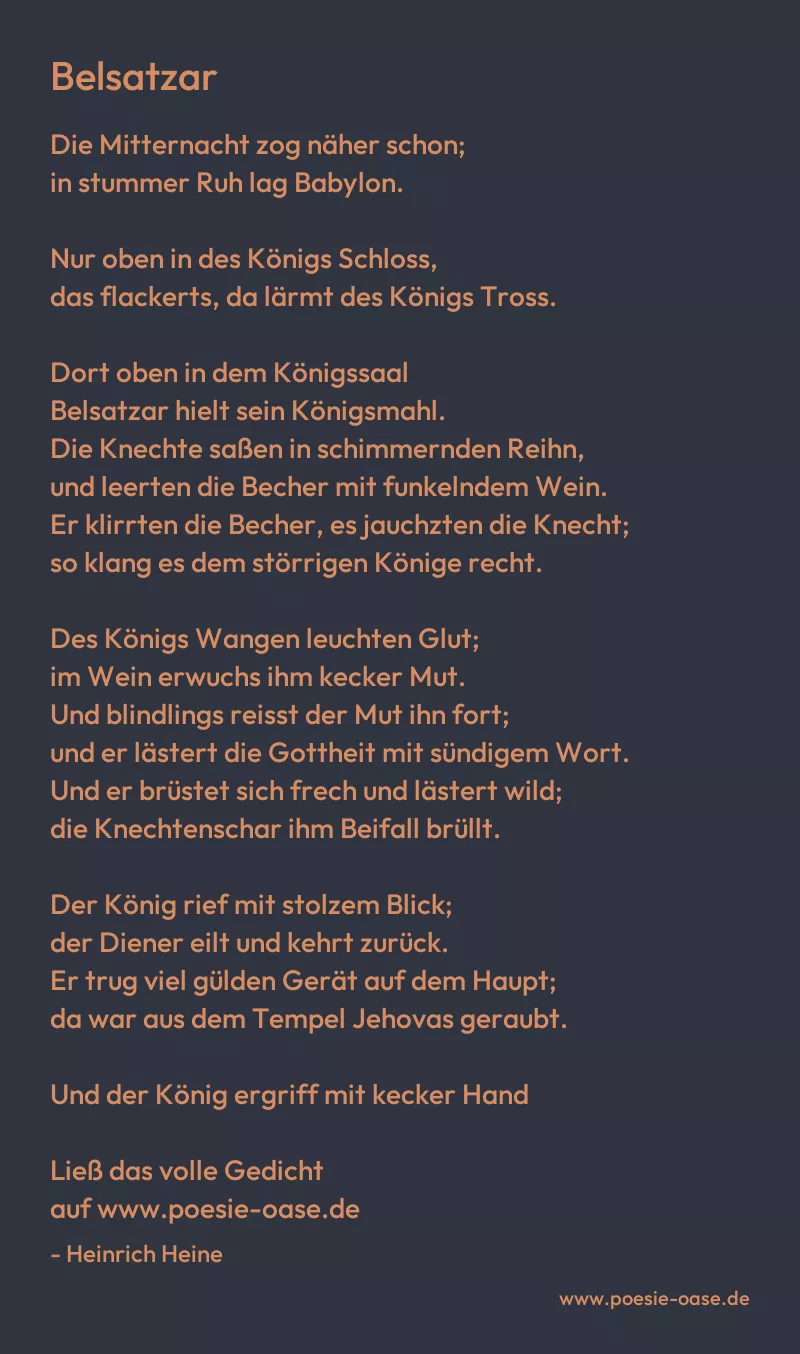Die Mitternacht zog näher schon;
in stummer Ruh lag Babylon.
Nur oben in des Königs Schloss,
das flackerts, da lärmt des Königs Tross.
Dort oben in dem Königssaal
Belsatzar hielt sein Königsmahl.
Die Knechte saßen in schimmernden Reihn,
und leerten die Becher mit funkelndem Wein.
Er klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht;
so klang es dem störrigen Könige recht.
Des Königs Wangen leuchten Glut;
im Wein erwuchs ihm kecker Mut.
Und blindlings reisst der Mut ihn fort;
und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort.
Und er brüstet sich frech und lästert wild;
die Knechtenschar ihm Beifall brüllt.
Der König rief mit stolzem Blick;
der Diener eilt und kehrt zurück.
Er trug viel gülden Gerät auf dem Haupt;
da war aus dem Tempel Jehovas geraubt.
Und der König ergriff mit kecker Hand
einen heiligen Becher, gefüllt bis am Rand.
Und er leert ihn hastig bis auf den Grund.
Und er rufet laut mit schäumendem Mund:
Jehova! Dir künd ich auf ewig Hohn –
ich bin der König von Babylon!
Doch kaum das grause Wort verklang,
dem König wards heimlich im Busen bang.
Das gellende Lachen verstummte zumal;
er wurde leichenstill im Saal.
Und sieh! und sieh! an weisser Wand
da kams hervor wie Menschenhand;
und schrieb, und schrieb an weisser Wand
Buchstaben von Feuer, und schrieb und schwand.
Der König stieren Blicks da saß,
mit schlotternden Knien und totenblass.
Die Knechtenschar saß kalt durchgraut,
und saß gar still, gab keinen Laut.
Die Magier kamen, doch keiner verstand
zu deuten die Flammenschrift an der Wand.
Belastzar ward aber in selbiger Nacht
von seinen Knechten umgebracht.