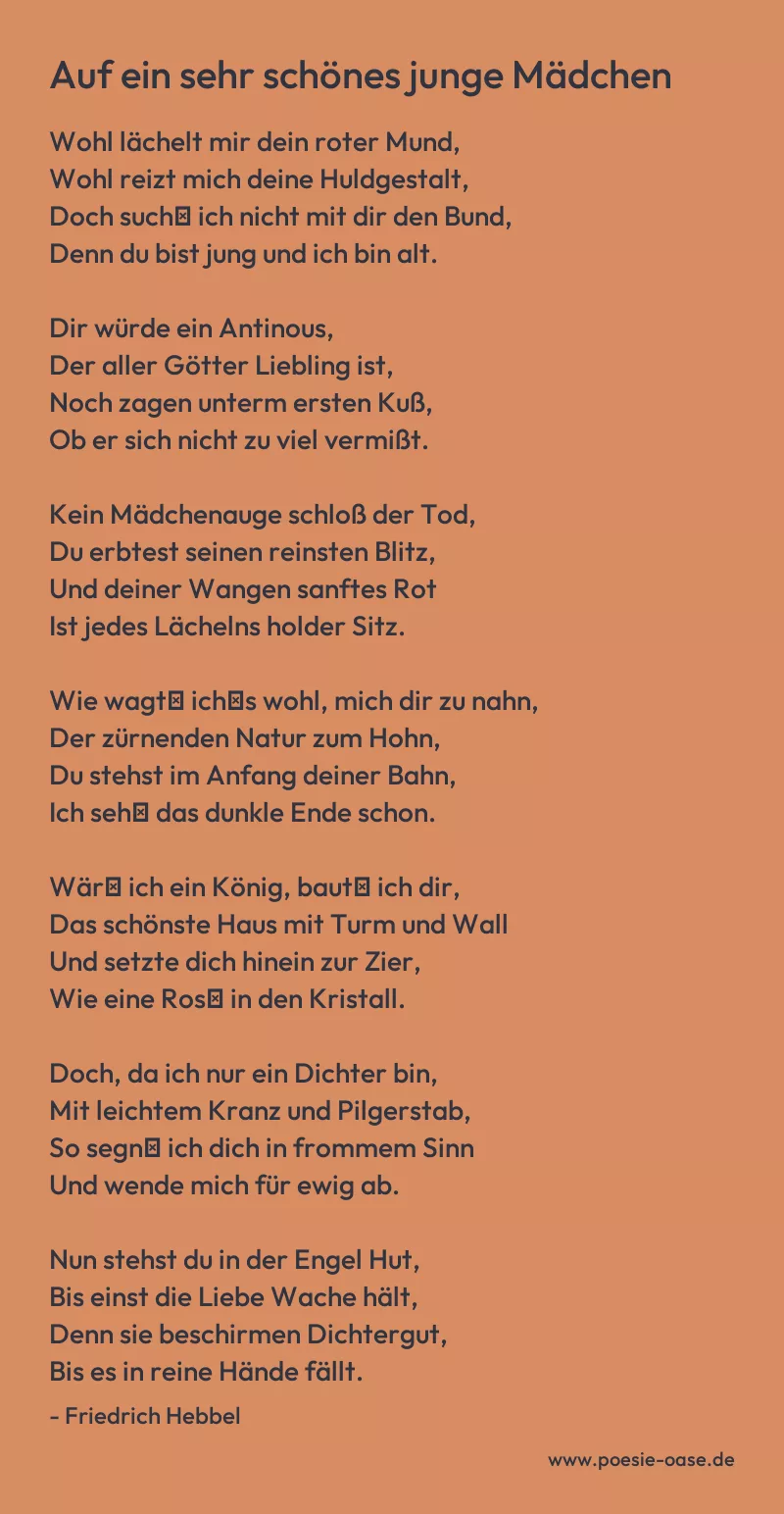Auf ein sehr schönes junge Mädchen
Wohl lächelt mir dein roter Mund,
Wohl reizt mich deine Huldgestalt,
Doch such′ ich nicht mit dir den Bund,
Denn du bist jung und ich bin alt.
Dir würde ein Antinous,
Der aller Götter Liebling ist,
Noch zagen unterm ersten Kuß,
Ob er sich nicht zu viel vermißt.
Kein Mädchenauge schloß der Tod,
Du erbtest seinen reinsten Blitz,
Und deiner Wangen sanftes Rot
Ist jedes Lächelns holder Sitz.
Wie wagt′ ich′s wohl, mich dir zu nahn,
Der zürnenden Natur zum Hohn,
Du stehst im Anfang deiner Bahn,
Ich seh′ das dunkle Ende schon.
Wär′ ich ein König, baut′ ich dir,
Das schönste Haus mit Turm und Wall
Und setzte dich hinein zur Zier,
Wie eine Ros′ in den Kristall.
Doch, da ich nur ein Dichter bin,
Mit leichtem Kranz und Pilgerstab,
So segn′ ich dich in frommem Sinn
Und wende mich für ewig ab.
Nun stehst du in der Engel Hut,
Bis einst die Liebe Wache hält,
Denn sie beschirmen Dichtergut,
Bis es in reine Hände fällt.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
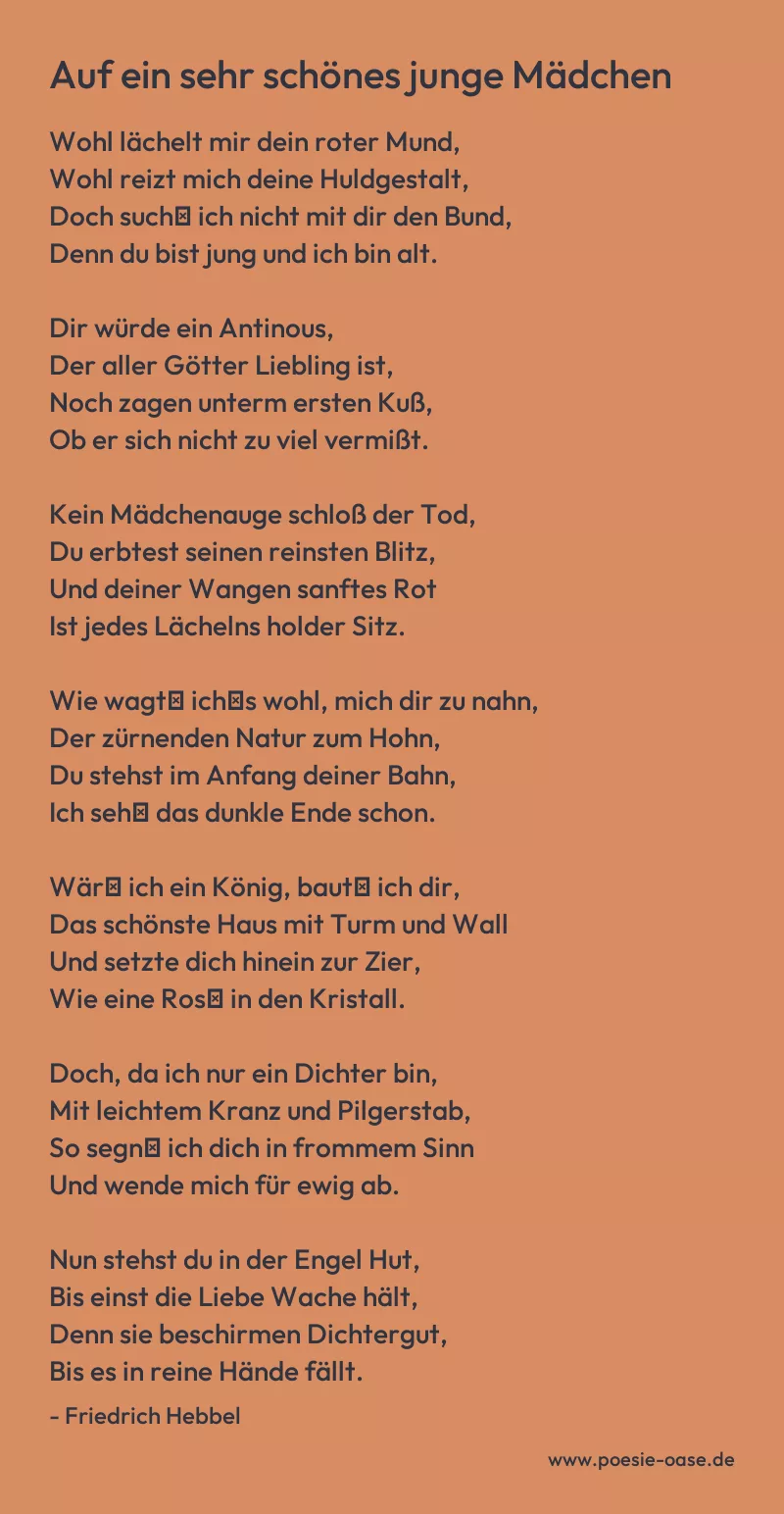
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Auf ein sehr schönes junges Mädchen“ von Friedrich Hebbel ist eine Reflexion über die Unvereinbarkeit von Jugend und Alter, Schönheit und Vergänglichkeit. Es ist durchzogen von einem melancholischen Ton, der die Erkenntnis des Dichters über die Unmöglichkeit einer Liebesbeziehung mit einer jungen Frau widerspiegelt. Der Dichter, der sich als „alt“ bezeichnet, erkennt die Schönheit und Anziehungskraft des Mädchens an, weiß aber, dass eine Beziehung aufgrund der natürlichen Unterschiede zum Scheitern verurteilt wäre.
Das Gedicht ist in mehrere Strophen unterteilt, die verschiedene Aspekte dieser Erkenntnis beleuchten. Die ersten Verse beschreiben die körperliche Anziehungskraft des Mädchens, doch die nachfolgenden Verse lenken den Blick auf das Problem des Altersunterschieds. Der Dichter fühlt sich zu alt, um mit dem Mädchen eine Beziehung einzugehen, und vergleicht sich mit einem „Antinous“, einer schönen, jugendlichen Gestalt. Die dritte Strophe thematisiert die Unberührtheit und Reinheit des Mädchens, das noch nicht vom Tod berührt wurde, während der Dichter das „dunkle Ende“ bereits vorausahnt.
Die vierte Strophe ist der zentrale Punkt des Gedichts. Hier spricht der Dichter die Natur als „zürnend“ an, da sie ihm die Möglichkeit einer Liebesbeziehung verwehrt. Er erkennt, dass das Mädchen am Anfang ihres Lebens steht, während er selbst dem Ende entgegengeht. Diese Einsicht ist von einer tiefen Traurigkeit geprägt, die durch die Erkenntnis verstärkt wird, dass er die „zürnende Natur“ nicht überwinden kann. In den folgenden Versen stellt der Dichter sich vor, er wäre ein König, um dem Mädchen Prunk und Herrlichkeit zu bieten, aber er ist lediglich ein Dichter.
In den abschließenden Strophen drückt der Dichter seinen Verzicht aus. Da er nur ein Dichter ist, kann er dem Mädchen nicht das bieten, was sie verdient. Er segnet sie, wendet sich aber von ihr ab, weil er weiß, dass eine Beziehung keine Zukunft hätte. Er überlässt sie der „Engel Hut“ und der Liebe, die eines Tages über sie wachen wird, was seine Hoffnung auf eine glückliche Zukunft für das Mädchen widerspiegelt. Das Gedicht endet mit einem Hauch von Sentimentalität und der Gewissheit des Dichters, dass seine Liebe für das Mädchen rein und unberührt bleiben muss.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.