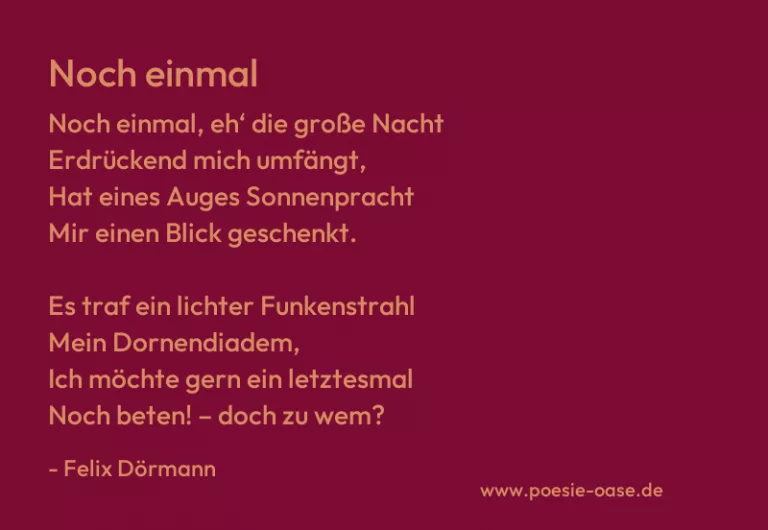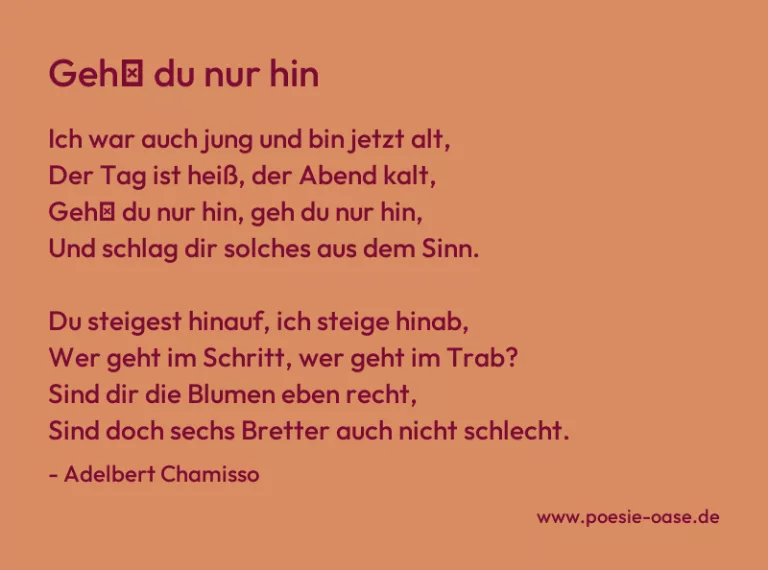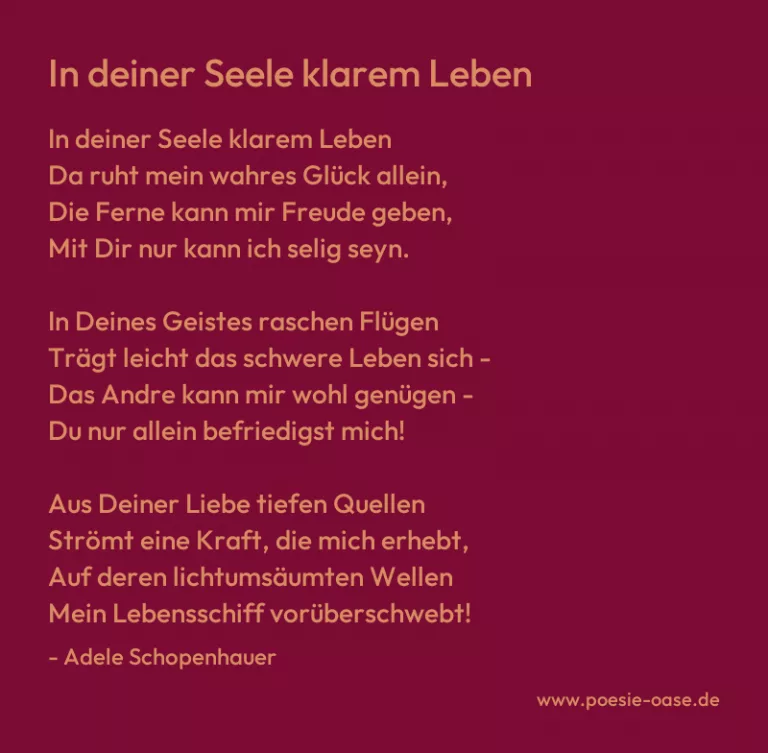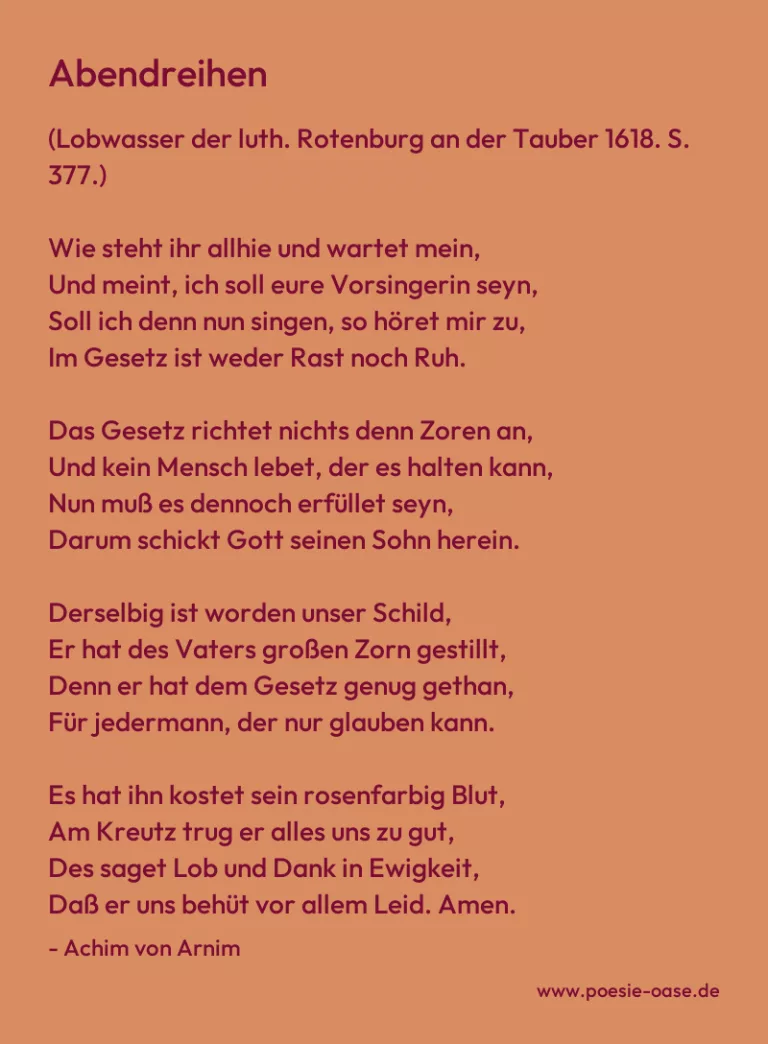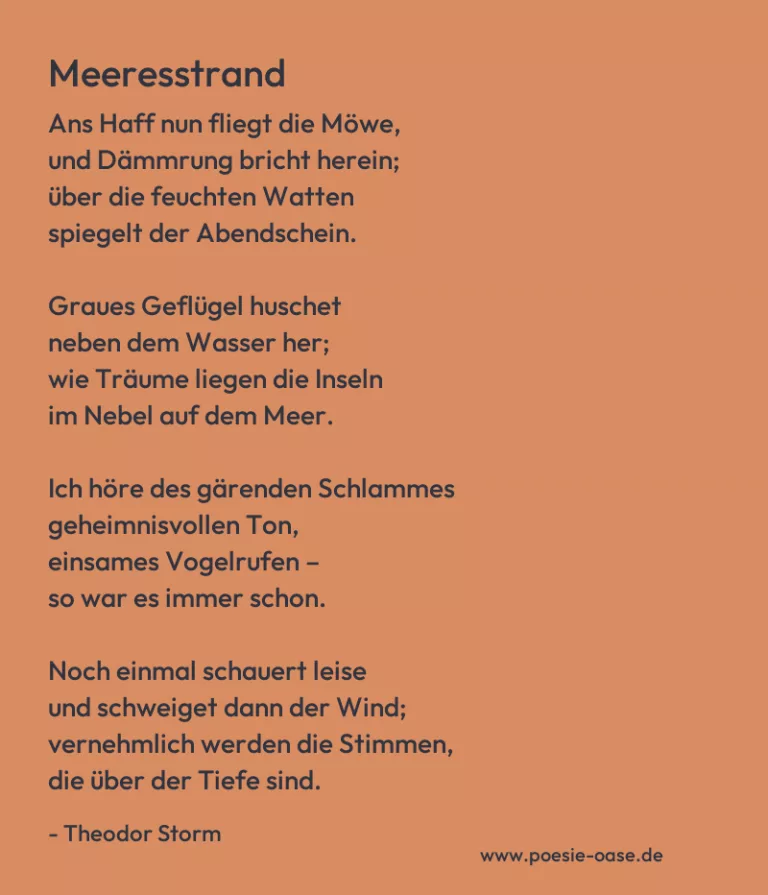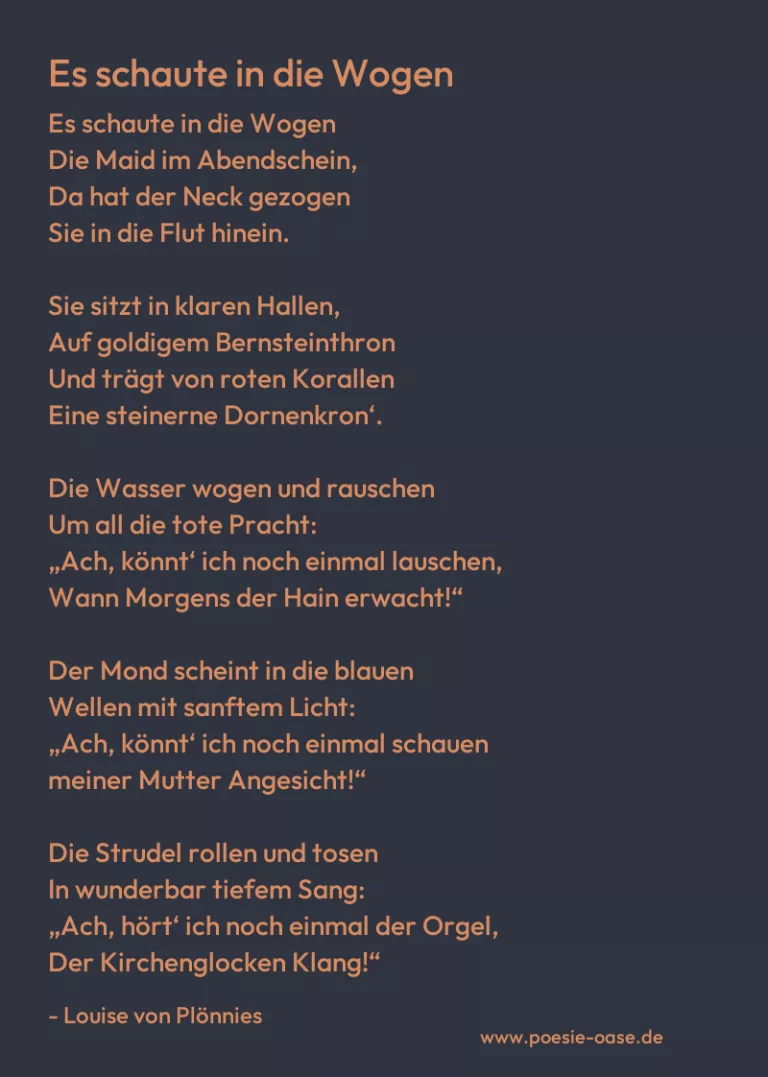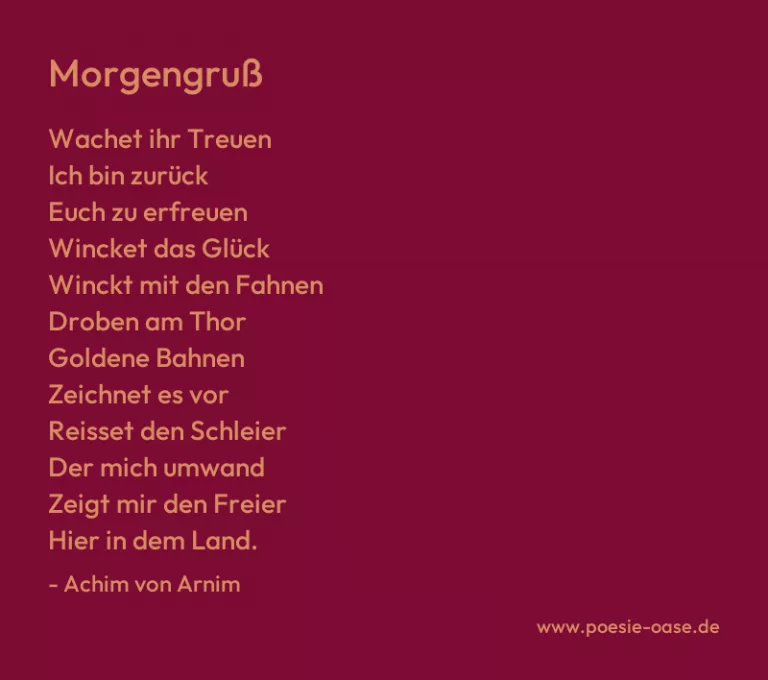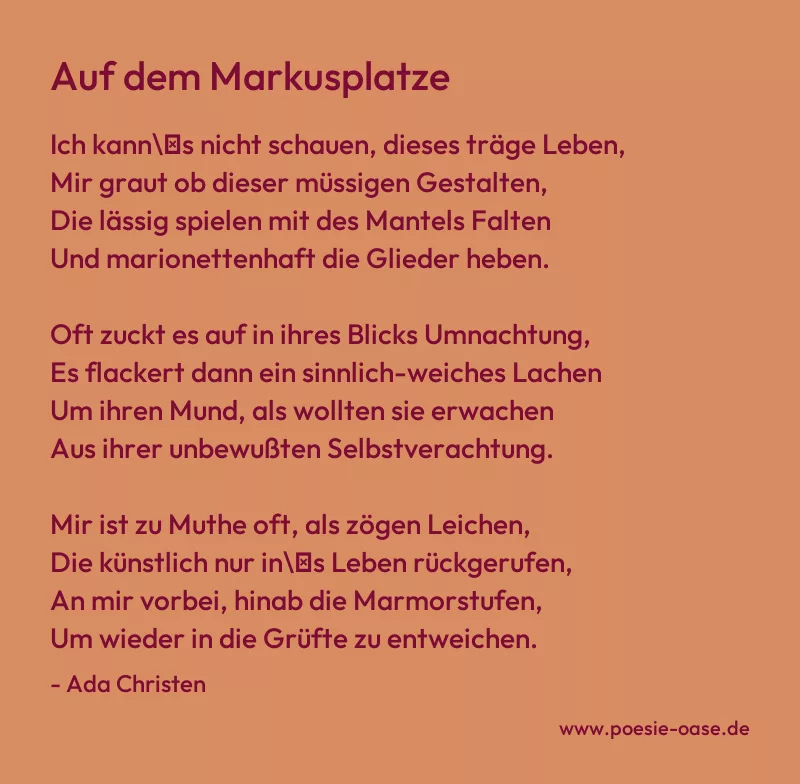Auf dem Markusplatze
Ich kann\′s nicht schauen, dieses träge Leben,
Mir graut ob dieser müssigen Gestalten,
Die lässig spielen mit des Mantels Falten
Und marionettenhaft die Glieder heben.
Oft zuckt es auf in ihres Blicks Umnachtung,
Es flackert dann ein sinnlich-weiches Lachen
Um ihren Mund, als wollten sie erwachen
Aus ihrer unbewußten Selbstverachtung.
Mir ist zu Muthe oft, als zögen Leichen,
Die künstlich nur in\′s Leben rückgerufen,
An mir vorbei, hinab die Marmorstufen,
Um wieder in die Grüfte zu entweichen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
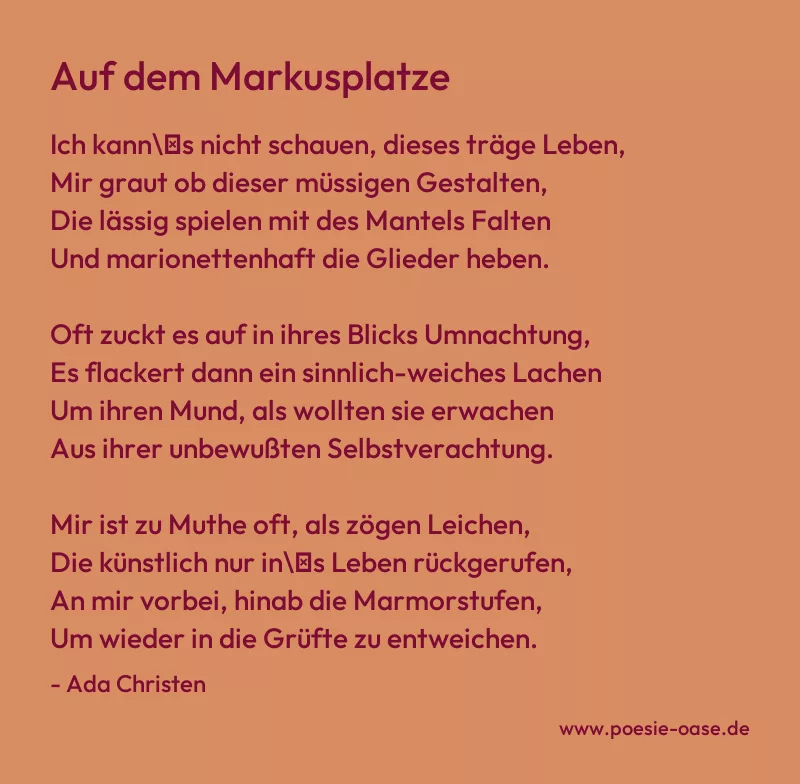
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „Auf dem Markusplatze“ von Ada Christen ist eine düstere Beobachtung der Menschen auf dem Markusplatz in Venedig, die von einer tiefen Ablehnung und einem Gefühl der Leere geprägt ist. Die Autorin, die vermutlich selbst auf dem Platz anwesend war, betrachtet die Menschenmassen mit einem distanzierten, fast angewiderten Blick. Ihre Worte vermitteln eine Atmosphäre von Trägheit, Künstlichkeit und innerer Leere, die sie in den dargestellten Gestalten zu erkennen meint.
Christen beginnt mit der Feststellung, dass sie das „träge Leben“ nicht ertragen kann. Dieses Gefühl wird verstärkt durch die Beschreibung der Menschen, die sie als „müssige Gestalten“ wahrnimmt. Diese Charaktere wirken wie Marionetten, die ihre Glieder „marionettenhaft“ heben. Die Beschreibung suggeriert eine fehlende Eigeninitiative und einen Mangel an echter Lebendigkeit. Nur flüchtig scheint ein Hauch von Emotion in ihren Blicken und in ihrem „sinnlich-weiches Lachen“ auf, das jedoch nicht von Dauer ist und sich schnell in die „unbewußte Selbstverachtung“ zurückverwandelt.
Der zweite Teil des Gedichts intensiviert die düstere Stimmung. Die Autorin verwendet das verstörende Bild von „Leichen“, die künstlich ins Leben zurückgerufen wurden. Dieses Bild unterstreicht die Wahrnehmung der Leere und der Künstlichkeit, die sie in den Menschen auf dem Platz sieht. Sie assoziiert sie mit dem Tod und der Vergänglichkeit, indem sie die „Marmorstufen“ hinabsteigen sieht, um in die „Grüfte zu entweichen“. Dies deutet auf ein Gefühl der Auflösung und des Nicht-Lebens hin, das die Menschen für die Autorin verkörpern.
Die Autorin scheint in den Menschen auf dem Markusplatz eine Oberflächlichkeit und eine innere Leere zu sehen, die sie zutiefst abstößt. Das Gedicht ist eine Kritik an der Trägheit und der Scheinwelt, die die Autorin in den Menschen und der Umgebung wahrzunehmen glaubt. Es ist eine Reflexion über die Vergänglichkeit des Lebens und die innere Leere, die hinter der Fassade von Schönheit und Genuss verborgen sein kann. Das Gedicht ist ein Ausdruck der Einsamkeit und des Unbehagens der Autorin angesichts des gesellschaftlichen Treibens.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.