Dunderschieß! Wer rennt mer in mi Gäu?
Isch’s der Gyßer? – ‘s isch bi miner Treu
Euer Glück, aß Ihr’s sind, Meister Gyßer!
Rime her! – Potz Fürio, und Miser-
ere, Domine! ‘s hätt schier verseit,
hätt mi nit d’Verzwiflung use treit.
Jez, was Euer Versli abetrifft,
uf mi Seecht, i bi voll Chib und Gift,
aß me Ratte mit mer chönnt verge.
Drum, i ha gmeint, ‘s chönn ‘s sust niemes meh,
weder ich, mit miner lange Pfife,
und Ihr wüsset’s au so schön z’begrife.
Lueget, ‘s Hamberch sott enander schelte,
doch, wil Ihr’s sind, willi ‘s Recht lo gelte.
Euer Versli isch so nett und gschlacht,
aß i schier mein, i heig’s selber gmacht.
Frili, wer’s bidenkt, es isch ke Wunder,
aß er’s chönnet, schla’ mi au der Dunder.
Ihr trinket urig Poesie
in lange Züge z’Müllen an der Post.
Tausig Sappermost,
isch sel nit e chospire Wi!
Aber chömmet, sind er’s echt im Stand,
doher au ne Rung ins Welschchornland,
sufet Prosa usem nasse Züber
in der Chuchi (‘s tribt mer d’Augen über);
sel bi Gollig luegt en anderst a.
Zwor i wil’s bikenne, jo i ha
au no Oberländer Poesie
imme Fäßli, und henk d’Zunge dri,
wenn’s nit go will. Aber ‘s isch ke Art,
nei es isch nüt, uf der sandige Hart.
He der wüsset’s wohl, i hannich jo
lang und mengmol gseh bim Füeßli stoh.
(Churz het Euch no niene niemes gseh,
wer’s bihauptet, seit ke Wohret meh.)
Selmols, traui, het’s au Batze gchost,
bis der füürig Geist in Eure Odere
und in Eurem Chopf het welle lodere,
und ‘s isch doch nit gsi, wie an der Post.
Neie wohl! Se hettich au der Schmid
z’Hüglen überlistet mit mim Lied!
So ne gscheite Ma, wie Ihr sust sind,
chauft e Chatz im Sack, und seig sie blind!
Geb der Himmel, aß sie schöner Art
und mit chloren Augen use fahrt,
wenni ‘s Säckli lös und lock und sag:
»Büüsli chumm, und loß di seh am Tag!«
Jez, Her Gyßer, bhüetich Gott der Her!
Haltet mer mi Grobheit für en Ehr!
Und Sanct Michael mit langem Säbel
Sollich bschirme! – Johann Peter Hebel.
Am fünften November Tusig Achthundert Zwei;
i hätt’s schier vergesse, mi armi Treu!
An Rechnungsrat Gyßer in Müllheim
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
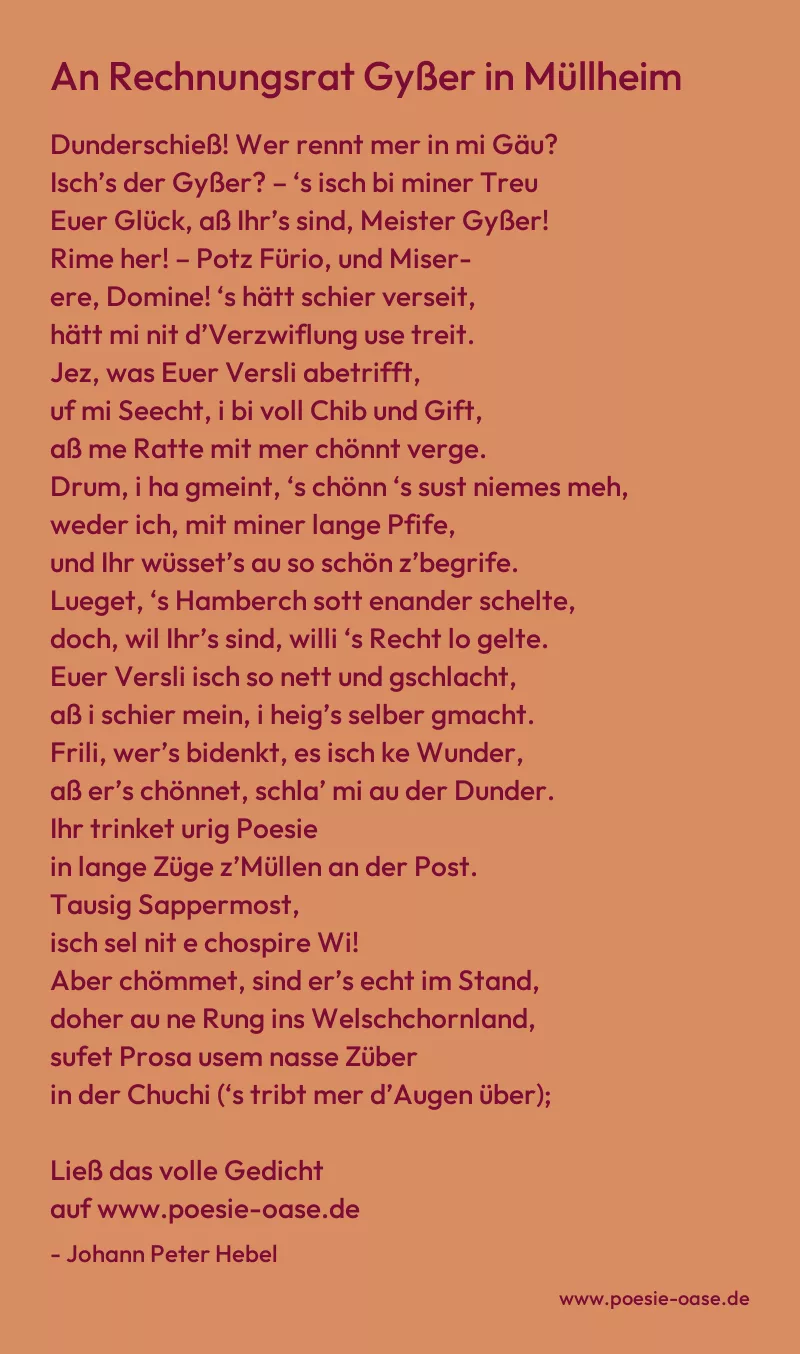
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An Rechnungsrat Gyßer in Müllheim“ von Johann Peter Hebel ist ein humorvoller Brief in alemannischer Mundart, der sowohl Lob als auch eine gewisse spöttische Distanz zum Adressaten, dem Rechnungsrat Gyßer, zum Ausdruck bringt. Die Interpretation ist geprägt von einem spielerischen Umgang mit Sprache und einem tiefen Verständnis für die Eigenheiten des ländlichen Lebens.
In den ersten Zeilen wird Gyßer herzlich begrüßt und sogleich die „Verzwiflung“ des Sprechers angedeutet, was bereits einen Hinweis auf die nachfolgende Auseinandersetzung gibt. Hebel drückt seine Bewunderung für Gyßers Gedicht aus, betont aber gleichzeitig seinen eigenen Stolz auf seine Fähigkeit, Verse zu verfassen. Die Metapher von „Chib und Gift“ deutet auf eine gewisse satirische Note hin, die Hebels Selbsteinschätzung kennzeichnet. Die Verwendung der Mundart trägt dazu bei, eine Vertrautheit und Authentizität zu erzeugen, die den humorvollen Ton des Gedichts verstärkt.
Der zweite Teil des Gedichts wendet sich der Poesie selbst zu. Hebel preist Gyßers Gabe, räumt aber zugleich ein, dass dieser im Vergleich zu ihm, der „urig Poesie“ aus der Post trinken kann, möglicherweise nicht ganz mithalten kann. Der Hinweis auf das Welschchornland und die dortige „Prosa“ suggeriert einen Unterschied zwischen den „poetischen“ Ambitionen Gyßers und der Qualität der Hebel’schen Gedichte, die die wahre Poesie verkörpern. Dies ist in erster Linie ein augenzwinkerndes Spiel, das die unterschiedlichen Herangehensweisen an die Poesie aufzeigt.
Der abschließende Teil des Gedichts ist von einer Mischung aus Lob, Neckerei und tieferer Wertschätzung geprägt. Hebel erinnert an die Mühen, die Gyßer mit der Poesie hatte, und zieht einen Vergleich mit einem „Katz im Sack“-Geschäft. Dies unterstreicht die Unvorhersehbarkeit des poetischen Schaffens und die Gefahr, sich von äußeren Eindrücken täuschen zu lassen. Der Gedicht endet mit einem frommen Wunsch und einer abschließenden Widmung, die die Freundschaft zwischen Hebel und Gyßer bekräftigt.
Insgesamt ist das Gedicht eine liebenswerte Momentaufnahme des dörflichen Lebens und des poetischen Schaffens, die durch Hebels meisterhafte Verwendung der Mundart und seinen spielerischen Umgang mit den Erwartungen der Leser besticht. Es ist eine humorvolle Reflexion über das Wesen der Poesie, die Freundschaft und die Eigenheiten des menschlichen Charakters. Das Gedicht feiert das Leben in all seinen Facetten, die kleinen Freuden, die menschlichen Eigenarten und die Bedeutung der Freundschaft.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
