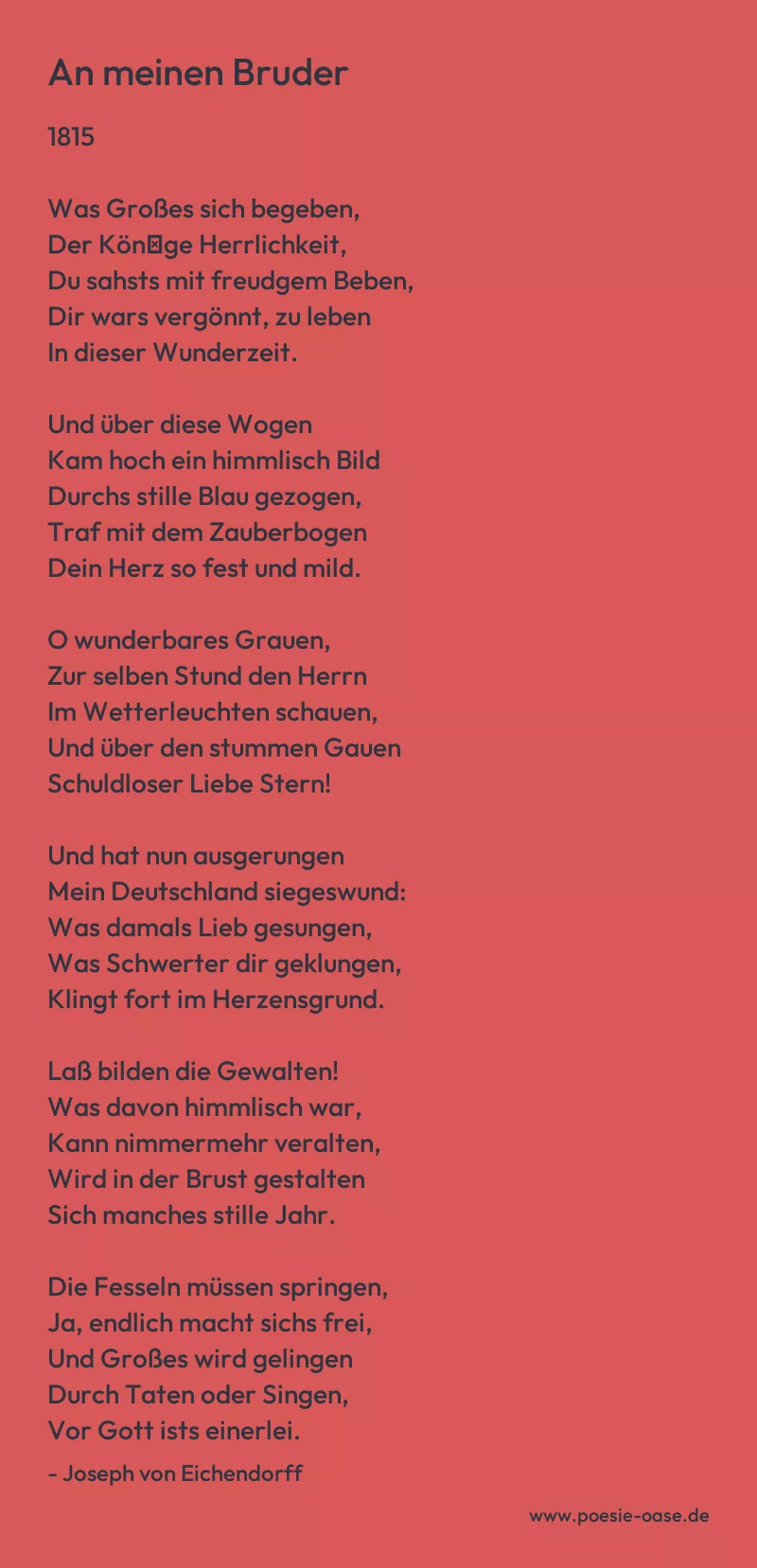An meinen Bruder
1815
Was Großes sich begeben,
Der Kön′ge Herrlichkeit,
Du sahsts mit freudgem Beben,
Dir wars vergönnt, zu leben
In dieser Wunderzeit.
Und über diese Wogen
Kam hoch ein himmlisch Bild
Durchs stille Blau gezogen,
Traf mit dem Zauberbogen
Dein Herz so fest und mild.
O wunderbares Grauen,
Zur selben Stund den Herrn
Im Wetterleuchten schauen,
Und über den stummen Gauen
Schuldloser Liebe Stern!
Und hat nun ausgerungen
Mein Deutschland siegeswund:
Was damals Lieb gesungen,
Was Schwerter dir geklungen,
Klingt fort im Herzensgrund.
Laß bilden die Gewalten!
Was davon himmlisch war,
Kann nimmermehr veralten,
Wird in der Brust gestalten
Sich manches stille Jahr.
Die Fesseln müssen springen,
Ja, endlich macht sichs frei,
Und Großes wird gelingen
Durch Taten oder Singen,
Vor Gott ists einerlei.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
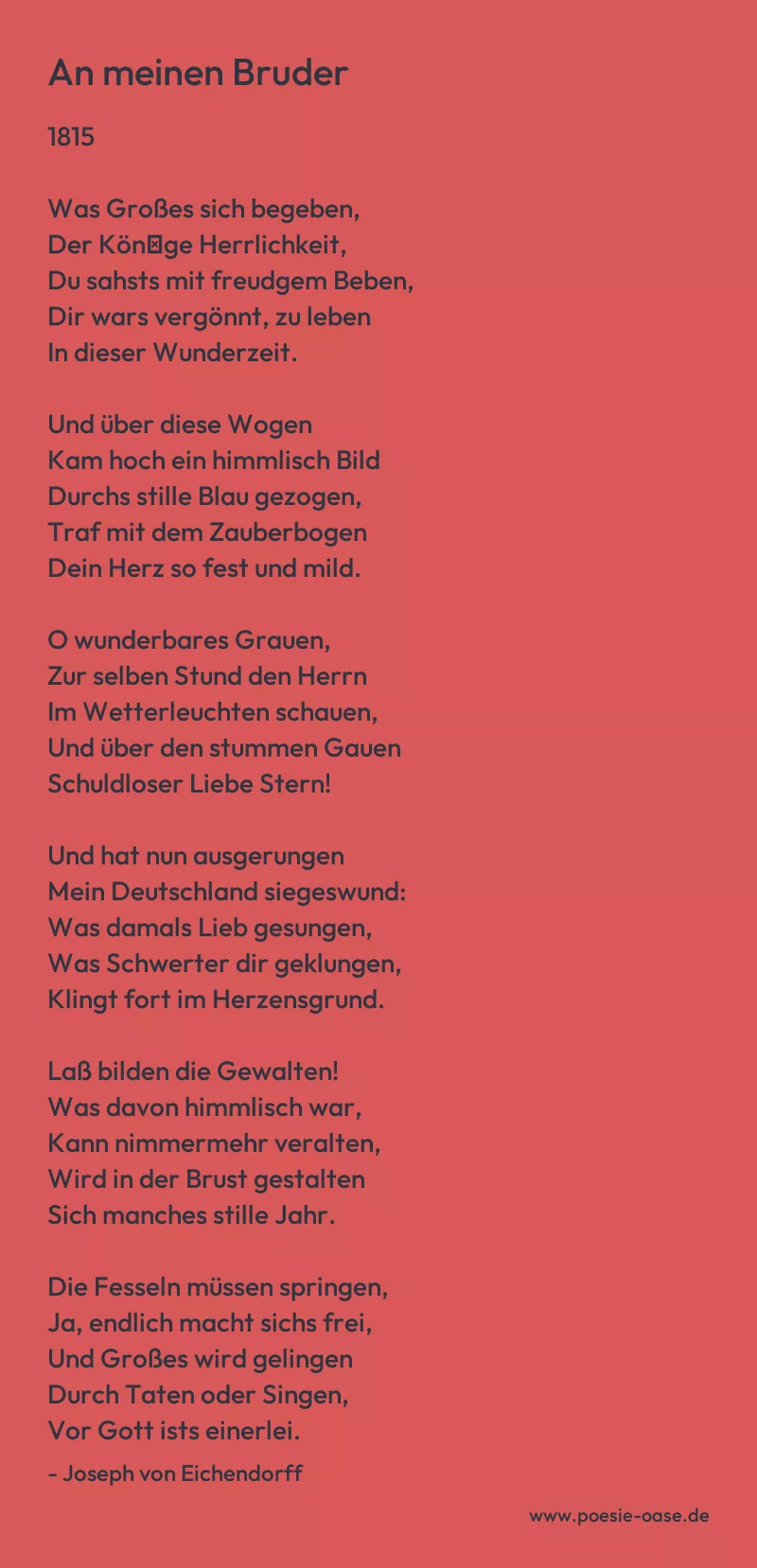
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An meinen Bruder“ von Joseph von Eichendorff ist eine feierliche Ode, die von den großen historischen Ereignissen der Zeit, insbesondere den Befreiungskriegen, geprägt ist und eine tiefgreifende Botschaft der Hoffnung und des Glaubens vermittelt. Es ist ein Gedicht, das von einem Gefühl des Erlebens einer bedeutsamen Epoche, der Freude über die gewonnene Freiheit und dem tiefen Vertrauen in eine höhere Macht durchzogen ist.
Das Gedicht beginnt mit der Beschreibung der Zeit, in der der Bruder lebte, eine Zeit voller „Großem“ und der „Herrlichkeit der Kön’ge“. Der Dichter hebt hervor, dass der Bruder Zeuge dieser bedeutsamen Ereignisse war und diese mit „freudgem Beben“ erlebte. Dies deutet auf eine tiefe emotionale Beteiligung und ein Gefühl der Ehrfurcht gegenüber dem Geschehen hin. Die Metapher des „himmlischen Bilds“ und des „Zauberbogens“ in der zweiten Strophe, das das Herz des Bruders traf, evozieren die Ideale und Werte, die in dieser Zeit wichtig waren: Freiheit, Ehre und Liebe zum Vaterland. Die Worte „wunderbares Grauen“ in der dritten Strophe, in der der Bruder den „Herrn“ im „Wetterleuchten“ sah, deuten auf ein spirituelles Erleben hin, das die Ereignisse der Welt mit einer göttlichen Dimension verbindet. Das Gedicht wird damit zu einem Lobgesang auf die gewonnene Freiheit und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft.
Die folgenden Strophen spiegeln die Auswirkungen der Ereignisse auf das innere Erleben des Bruders wider. Das „was damals Lieb gesungen“ und „was Schwerter dir geklungen“ (Strophe 4) finden ihren Widerhall im „Herzensgrund“. Das Gedicht beschwört die bleibende Wirkung der Kriegserfahrungen und der damit verbundenen Ideale und die Erschaffung einer neuen Ordnung. Die fünfte Strophe ruft dazu auf, das Himmlische zu bewahren, da es „nimmermehr veralten“ kann und sich in den „Brust gestalten“ wird – eine Aufforderung, die Ideale und Werte in Ehren zu halten. Die sechste und letzte Strophe enthält eine klare Botschaft der Hoffnung und des Glaubens an die Freiheit, indem sie die Notwendigkeit des Aufbruchs betont und schließlich die Einheit von Handeln und Singen vor Gott hervorhebt.
Insgesamt ist „An meinen Bruder“ ein Gedicht, das die Erfahrungen einer historischen Epoche, die Gefühle der Freude und des Schreckens sowie die Hoffnung auf eine bessere Zukunft vereint. Eichendorff verbindet persönliche Emotionen mit der Größe der historischen Ereignisse und schafft so ein ergreifendes Zeugnis für die Ideale, die die Menschen in dieser Zeit bewegten, und für den unerschütterlichen Glauben an eine höhere Macht. Das Gedicht ist ein Ausdruck der Dankbarkeit, der Hoffnung und des Glaubens, der in einer Zeit des Umbruchs und der Neuausrichtung besonders wertvoll war.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.