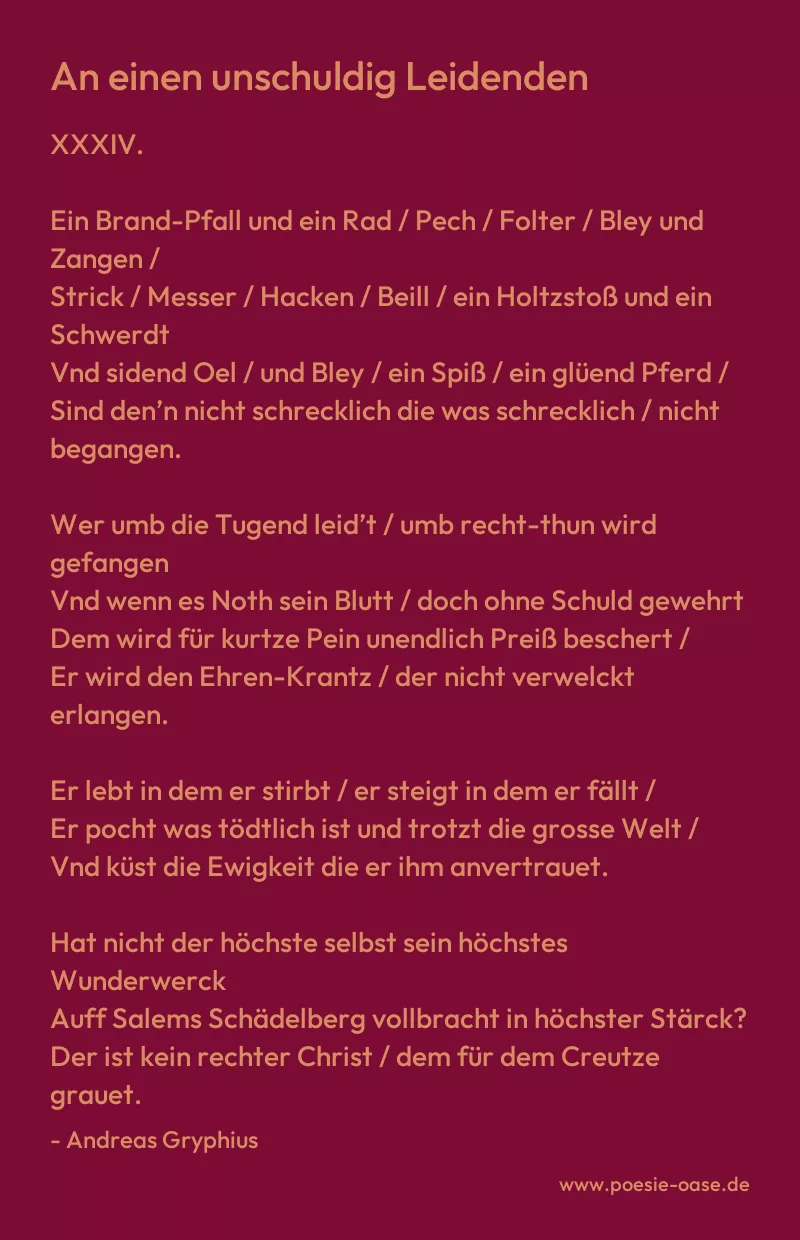An einen unschuldig Leidenden
XXXIV.
Ein Brand-Pfall und ein Rad / Pech / Folter / Bley und Zangen /
Strick / Messer / Hacken / Beill / ein Holtzstoß und ein Schwerdt
Vnd sidend Oel / und Bley / ein Spiß / ein glüend Pferd /
Sind den’n nicht schrecklich die was schrecklich / nicht begangen.
Wer umb die Tugend leid’t / umb recht-thun wird gefangen
Vnd wenn es Noth sein Blutt / doch ohne Schuld gewehrt
Dem wird für kurtze Pein unendlich Preiß beschert /
Er wird den Ehren-Krantz / der nicht verwelckt erlangen.
Er lebt in dem er stirbt / er steigt in dem er fällt /
Er pocht was tödtlich ist und trotzt die grosse Welt /
Vnd küst die Ewigkeit die er ihm anvertrauet.
Hat nicht der höchste selbst sein höchstes Wunderwerck
Auff Salems Schädelberg vollbracht in höchster Stärck?
Der ist kein rechter Christ / dem für dem Creutze grauet.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
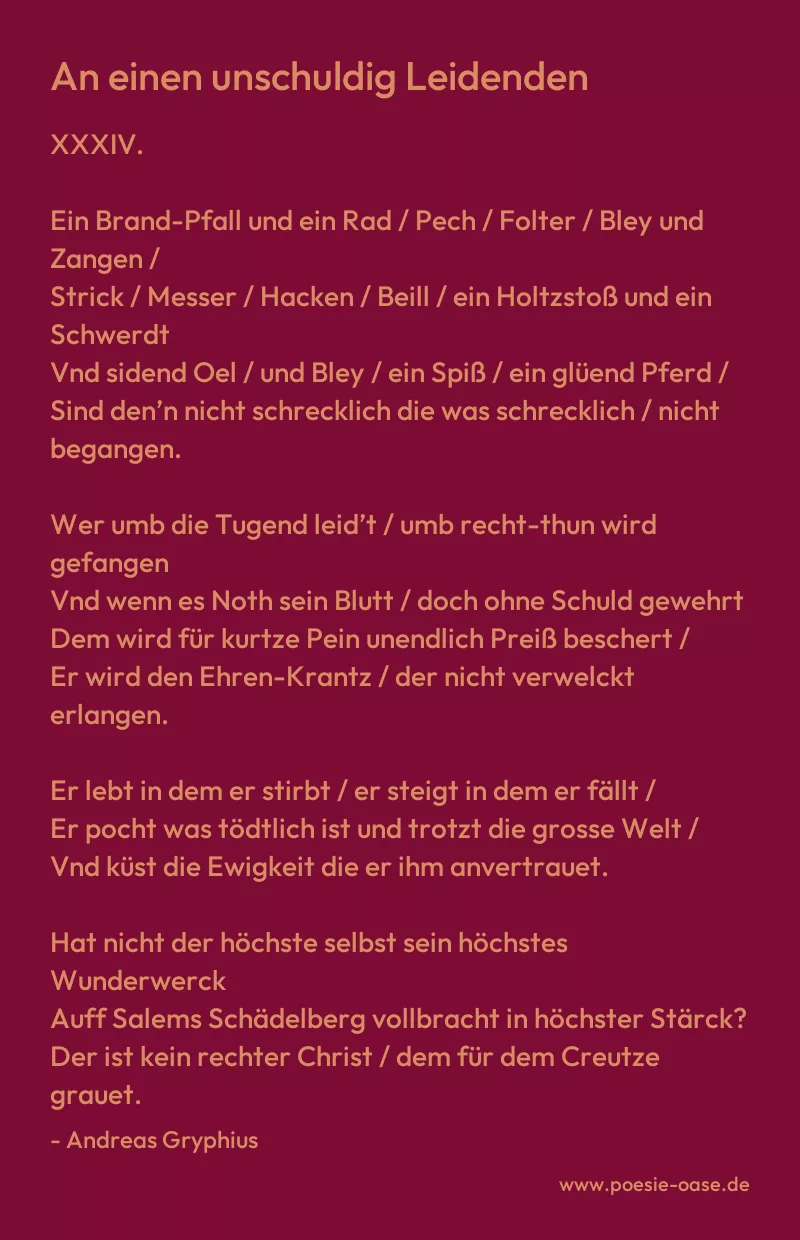
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An einen unschuldig Leidenden“ von Andreas Gryphius ist eine tiefgründige Auseinandersetzung mit dem Thema des Leidens und der Tugendhaftigkeit im Angesicht von Gewalt und Verfolgung. Es entwirft ein düsteres Bild der Grausamkeit, um im Kontrast dazu die erhabene Kraft der Tugend und die Hoffnung auf eine ewige Belohnung hervorzuheben. Das Gedicht ist in zwei Teile gegliedert: Zuerst werden die physischen Qualen beschrieben, die einem Unschuldigen widerfahren können, dann folgt die Betonung der spirituellen Erhebung durch das Leiden.
Der erste Teil des Gedichts listet eine Reihe von Folterwerkzeugen und gewalttätigen Praktiken auf: „Brand-Pfall und ein Rad / Pech / Folter / Bley und Zangen / Strick / Messer / Hacken / Beill / ein Holtzstoß und ein Schwerdt / Vnd sidend Oel / und Bley / ein Spiß / ein glüend Pferd“. Diese Aufzählung erzeugt ein Gefühl der Beklemmung und des Grauens. Gryphius präsentiert hier ein erschreckendes Arsenal, das die physischen Grenzen des Menschen aufzeigt. Die Absicht ist, die Härte der erlittenen Qualen zu verdeutlichen und gleichzeitig die innere Stärke des Leidenden hervorzuheben, der sich diesen Schrecken stellt. Die Gewalt dient lediglich als Hintergrund, vor dem die wahre Größe der Tugend sichtbar wird.
Der zweite Teil des Gedichts wechselt von der Darstellung äußerer Gewalt zur Betonung der inneren Erhebung. Der Dichter verspricht dem, der „umb die Tugend leid’t“, eine ewige Belohnung: „Dem wird für kurtze Pein unendlich Preiß beschert / Er wird den Ehren-Krantz / der nicht verwelckt erlangen.“ Das Leiden wird hier als Weg zur Erlösung interpretiert. Das Gedicht betont, dass der Leidende durch sein Opfer letztlich ein ewiges Leben erlangt. Der Fokus liegt auf der Überwindung der irdischen Beschränkungen und der Erreichung eines transzendenten Zustands.
Der Bezug zum Kreuz Christi, der im abschließenden Teil des Gedichts hergestellt wird, ist von zentraler Bedeutung. Die Zeilen „Hat nicht der höchste selbst sein höchstes Wunderwerck / Auff Salems Schädelberg vollbracht in höchster Stärck? / Der ist kein rechter Christ / dem für dem Creutze grauet“ erinnern an die Leiden Jesu und dienen als ultimatives Beispiel für die unschuldige Hingabe. Das Gedicht fordert die Leser auf, die Lehren Christi anzunehmen und sich nicht vor dem Leiden zu fürchten. Der wahre Christ, so die Aussage, ist jemand, der bereit ist, das Kreuz anzunehmen und dem Leiden mit unerschütterlicher Glauben entgegenzutreten. Gryphius verbindet somit die weltliche Erfahrung des Leidens mit der religiösen Vorstellung von Erlösung und ewiger Freude.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.