Du kennst den Grund der Festungswerke.
Mit einem Blicke messest du
Der Schanzen und der Mauern Stärke;
Doch meine Muse ruft dir zu:
So wahr, als Friedrich unvergessen
Bewundert wird in später Zeit,
So wahr ist dies Unmöglichkeit
Des Herzens Tiefen auszumessen.
Sei klug, bedenke dich so schlau
Wie einst Ulysses ist gewesen,
Nie wirst du der verschmitzten Frau
Verborgenste Gedanken lesen.
Sie decket ihre feinste List
Mit Blumen zu, bis du gefangen
Gleich einem Dohnenvogel bist.
Sie schmachtet, seufzt, netzt ihre Wangen
Mit Thränen, die sie künftig weint.
Sie nennt dich oft in einer Stunde
Wohl tausendmal den besten Freund,
Und schwört mit schmeichlerischem Munde
Beim Grabmal ihres Vaters, bei
Den Sternen und bei allen Göttern,
Bei Sonnenschein und Donnerwettern,
Daß ihr dein Kuß noch süßer sei,
Als Süßigkeit von jungen Bienen;
Und zaubert dich mit holden Mienen
An ihre giftbestrichne Brust
Und nennt dich ihre größte Lust,
Den ersten Abgott ihrer Seele,
Den reichsten Jüngling von der Welt,
Den Menschen, der in einer Höhle
Mehr ihren Augen wohlgefällt,
Als Prinzen, die so fein nicht fühlen
Im Prunksaal und auf goldnen Stühlen
Und einer sammtbezognen Bank.
Sie stellt sich gar vor Liebe krank,
Und redet nur gebrochne Töne.
O sanfter Jüngling, glaub es nicht:
Es ist die Stimme der Syrene,
Die ausstudirte Worte spricht.
An einen Ingenieur, Liebhaber der Phyllis
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
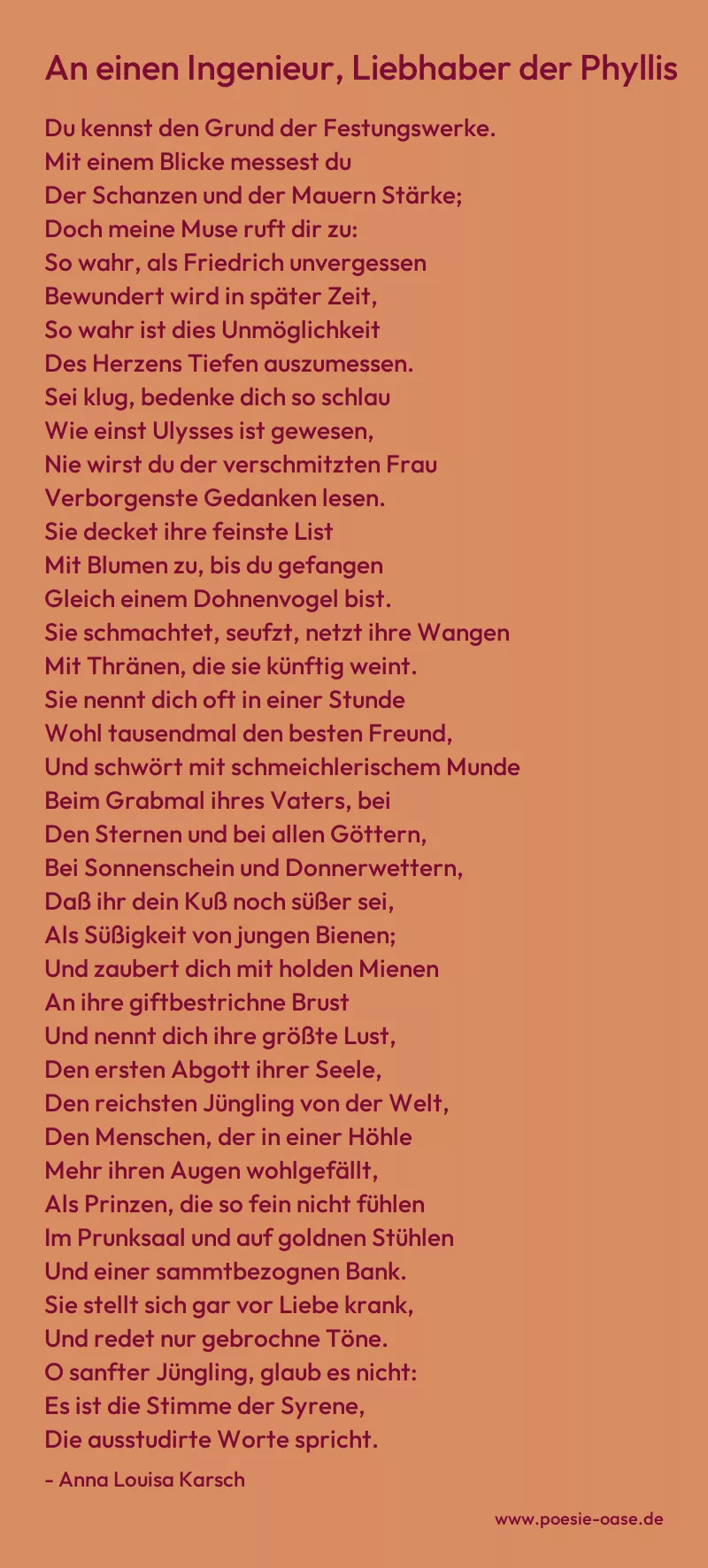
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An einen Ingenieur, Liebhaber der Phyllis“ von Anna Louisa Karsch ist eine warnende Auseinandersetzung mit der Liebe und dem Wesen einer Frau, hier verkörpert durch die fiktive Phyllis. Es spricht einen Ingenieur an, der als Mann der Wissenschaft und der messbaren Fakten dargestellt wird, und warnt ihn vor der Unberechenbarkeit und Undurchschaubarkeit der Frau, deren „Herzens Tiefen“ er niemals ergründen können wird. Die Metapher der Festungswerke, die der Ingenieur zu verstehen und zu vermessen versteht, steht im Kontrast zu den unmessbaren Gefühlswelten der Frau.
Karsch bedient sich verschiedener rhetorischer Figuren, um die Gefährlichkeit der Liebe und der „verschmitzten Frau“ zu verdeutlichen. Die Frau wird mit List und Täuschung in Verbindung gebracht, sie „decket ihre feinste List mit Blumen zu“, um den Mann zu fesseln, wie ein Dornenvogel in einer Falle. Sie nutzt emotionale Erpressung durch Tränen und Schwüre, um ihre Ziele zu erreichen, und bedient sich übertriebener Lobpreisungen, um den Mann zu manipulieren. Die Vergleiche mit der Stimme der Sirene unterstreichen die verführerische und zugleich gefährliche Natur der Frau.
Die Autorin verwendet eine bildhafte Sprache, um die Verführungskraft der Frau zu beschreiben. Sie „zaubert“ den Mann an ihre „giftbestrichne Brust“ und beschreibt sie als seinen „ersten Abgott“. Diese drastischen Formulierungen zeigen die verheerenden Auswirkungen der Leidenschaft und warnen vor der Blindheit, die durch die Liebe entstehen kann. Die Gegensätze, wie die „giftbestrichne Brust“ und die süßen Worte, verdeutlichen die Täuschung. Die Ironie liegt darin, dass die Frau den Ingenieur als den „reichsten Jüngling von der Welt“ bezeichnet, während er tatsächlich derjenige ist, der durch ihre Täuschung verarmt wird.
Das Gedicht ist nicht nur eine Warnung vor der List der Frau, sondern auch eine Kritik an der romantisierenden Vorstellung der Liebe. Karsch deutet an, dass die Liebe oft von Berechnung und Täuschung geprägt ist. Der Ingenieur, als Inbegriff des rationalen Denkens, wird aufgefordert, seine Fähigkeiten der Analyse und Messung in Bezug auf die Liebe zu überdenken. Die Botschaft ist klar: Liebe ist komplexer und weniger greifbar als die Gesetze der Physik und der Konstruktion, und die Anwendung rationaler Prinzipien kann in diesem Bereich zum Scheitern verurteilt sein.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
