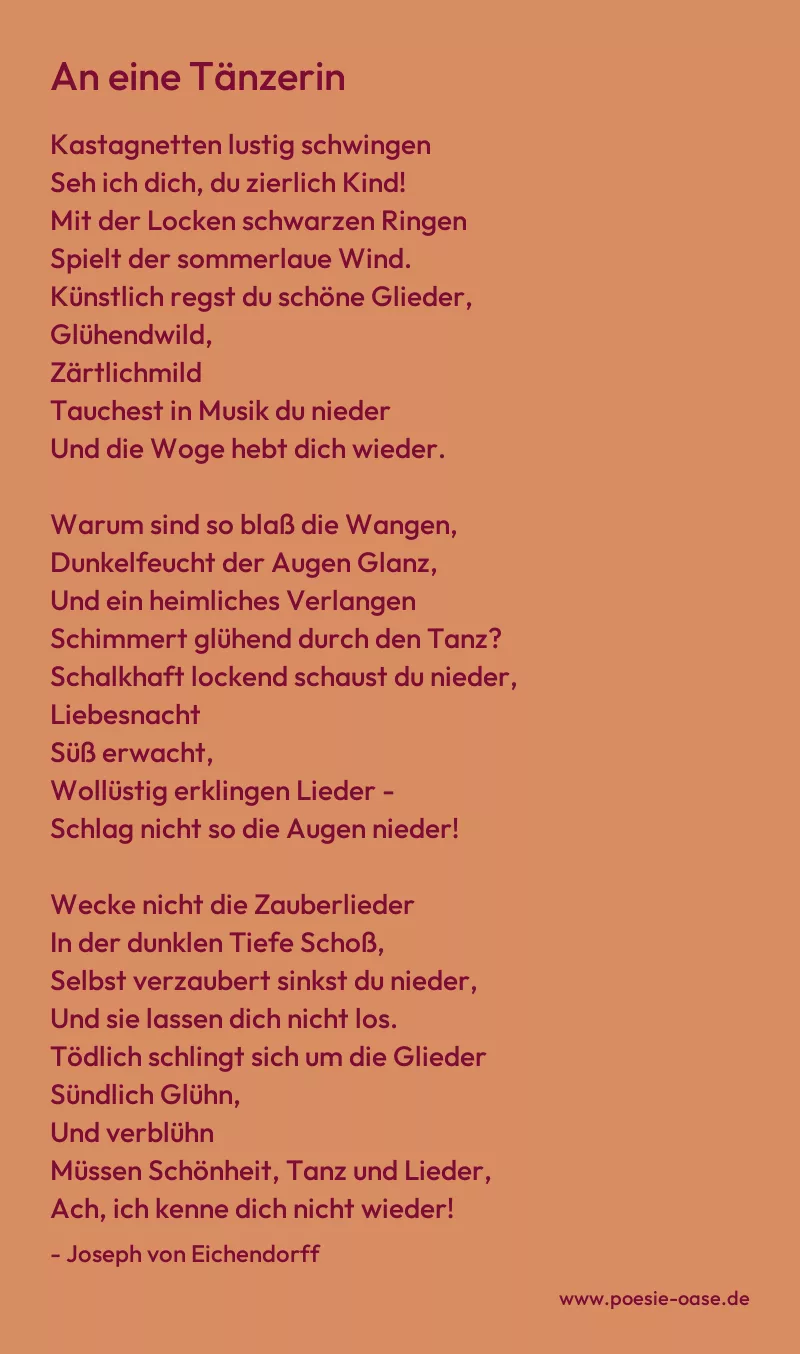An eine Tänzerin
Kastagnetten lustig schwingen
Seh ich dich, du zierlich Kind!
Mit der Locken schwarzen Ringen
Spielt der sommerlaue Wind.
Künstlich regst du schöne Glieder,
Glühendwild,
Zärtlichmild
Tauchest in Musik du nieder
Und die Woge hebt dich wieder.
Warum sind so blaß die Wangen,
Dunkelfeucht der Augen Glanz,
Und ein heimliches Verlangen
Schimmert glühend durch den Tanz?
Schalkhaft lockend schaust du nieder,
Liebesnacht
Süß erwacht,
Wollüstig erklingen Lieder –
Schlag nicht so die Augen nieder!
Wecke nicht die Zauberlieder
In der dunklen Tiefe Schoß,
Selbst verzaubert sinkst du nieder,
Und sie lassen dich nicht los.
Tödlich schlingt sich um die Glieder
Sündlich Glühn,
Und verblühn
Müssen Schönheit, Tanz und Lieder,
Ach, ich kenne dich nicht wieder!
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
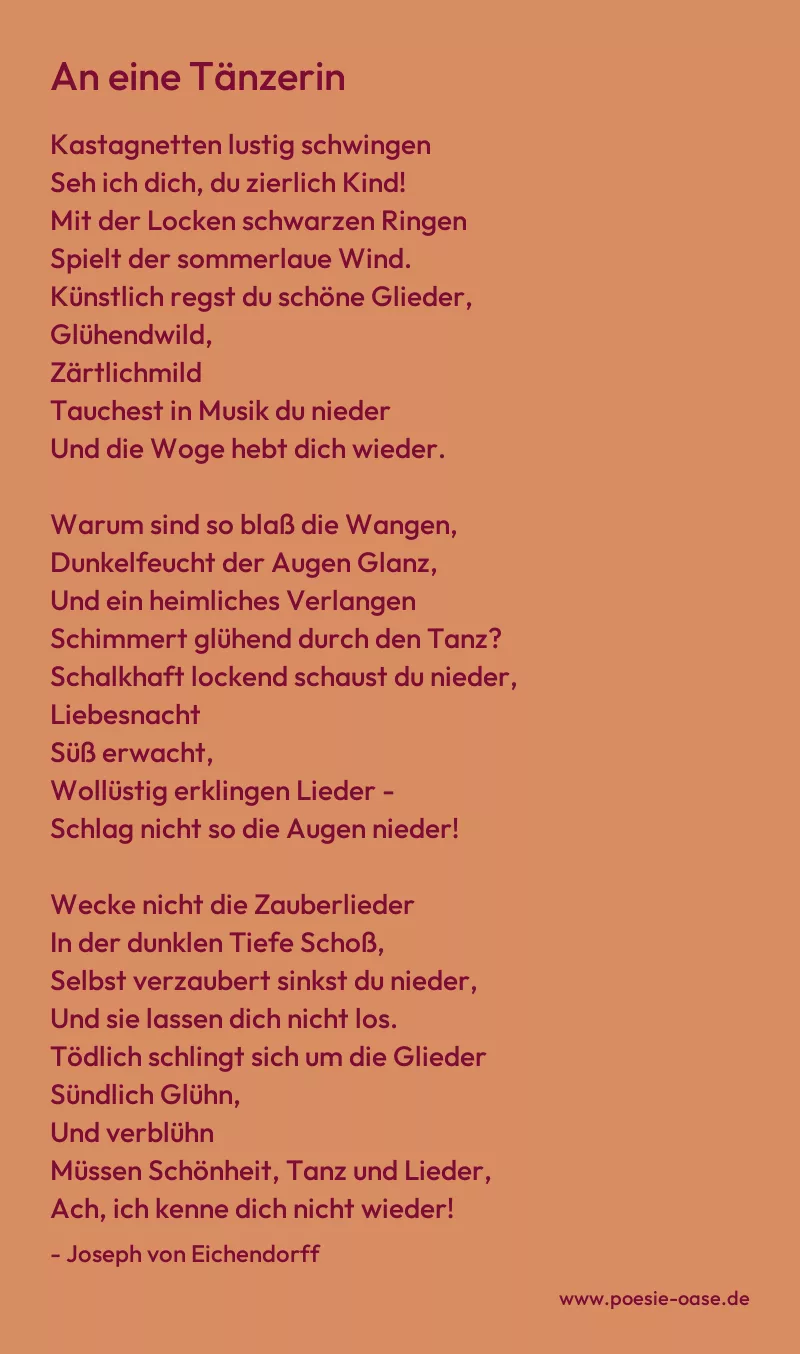
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An eine Tänzerin“ von Joseph von Eichendorff beschreibt in zwei Strophen das Bild einer Tänzerin, um dann in der dritten Strophe eine düstere Entwicklung anzudeuten. In der ersten Strophe wird die Tänzerin als ein „zierlich Kind“ dargestellt, dessen Tanz von Kastagnetten, dem Wind in den Locken und der Musik begleitet wird. Die Beschreibung ist von Leichtigkeit und Anmut geprägt, wobei die Metapher des „Tauch[ens] in Musik“ die Verschmelzung der Tänzerin mit der Musik andeutet. Der Ausdruck „glühendwild“ deutet jedoch bereits auf eine innere, leidenschaftliche Komponente hin, die sich unter der Oberfläche des Tanzes verbirgt.
Die zweite Strophe wirft Fragen nach dem eigentlichen Wesen der Tänzerin auf. Die „blaß[en] Wangen“ und der „dunkelfeucht[e] Augen Glanz“ deuten auf eine gewisse Melancholie und ein verborgenes Verlangen hin. Der Tanz wird hier zu einem Ausdruck dieses Verlangens, das „schalkhaft lockend“ zum Vorschein kommt. Die Zeilen „Liebesnacht / Süß erwacht“ und „Wollüstig erklingen Lieder“ lassen erahnen, dass der Tanz eine erotische Komponente besitzt, die jedoch auch eine gewisse Gefahr birgt. Die Aufforderung „Schlag nicht so die Augen nieder!“ deutet auf eine Warnung vor der Hingabe an diese Leidenschaft hin.
Die dritte Strophe kippt die Stimmung endgültig ins Tragische. Die „Zauberlieder“ werden als etwas beschrieben, das aus der „dunklen Tiefe Schoß“ geweckt wird und die Tänzerin in einen Bann zieht. Die Worte „Selbst verzaubert sinkst du nieder / Und sie lassen dich nicht los“ verdeutlichen das Gefühl der Unentrinnbarkeit, des Verfalls. Die Metapher des „tödlich[en] Schlingens“ des „sündlich[en] Glühns“ deutet auf eine zerstörerische Kraft der Leidenschaft hin, der die Schönheit, der Tanz und die Lieder zum Opfer fallen. Der letzte Vers, „Ach, ich kenne dich nicht wieder!“, drückt die Verwandlung und das endgültige Scheitern der Tänzerin aus.
Eichendorff nutzt in diesem Gedicht bildreiche Sprache und eine klare Struktur, um die Entwicklung der Tänzerin von einer anmutigen Erscheinung zu einem Opfer der eigenen Leidenschaft zu beschreiben. Das Gedicht thematisiert die Dualität von Schönheit und Verfall, von Anmut und Verlangen sowie die zerstörerische Kraft unerfüllter Sehnsüchte. Die „Zauberlieder“ und das „sündlich Glühn“ stehen symbolisch für die dunklen, verlockenden Seiten des Lebens, die die Tänzerin in den Abgrund ziehen. Die abschließenden Zeilen lassen den Leser mit dem Gefühl des Verlusts und der Tragik zurück.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.