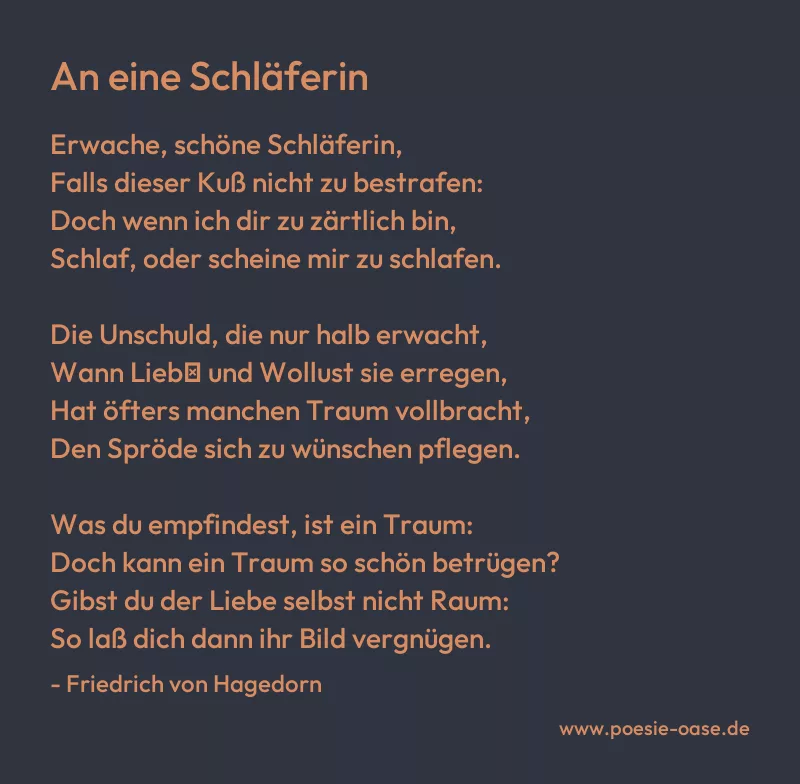An eine Schläferin
Erwache, schöne Schläferin,
Falls dieser Kuß nicht zu bestrafen:
Doch wenn ich dir zu zärtlich bin,
Schlaf, oder scheine mir zu schlafen.
Die Unschuld, die nur halb erwacht,
Wann Lieb′ und Wollust sie erregen,
Hat öfters manchen Traum vollbracht,
Den Spröde sich zu wünschen pflegen.
Was du empfindest, ist ein Traum:
Doch kann ein Traum so schön betrügen?
Gibst du der Liebe selbst nicht Raum:
So laß dich dann ihr Bild vergnügen.
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
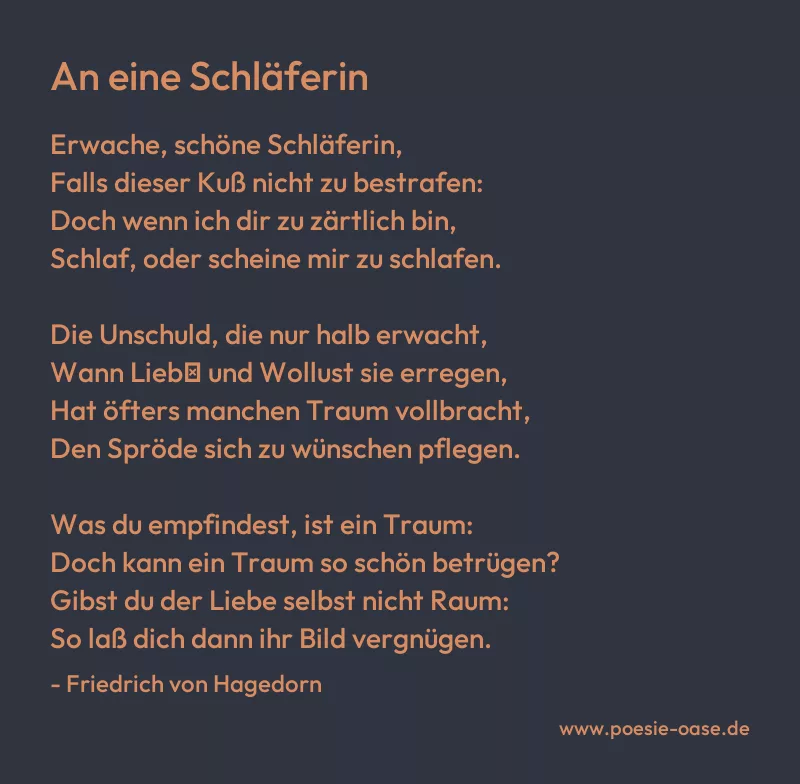
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An eine Schläferin“ von Friedrich von Hagedorn ist eine charmante Anspielung auf die Momente des Aufbruchs und des Übergangs zwischen Schlaf und Wachsein, gepaart mit einer subtilen Anspielung auf erotische Anziehungskraft. Die ersten beiden Verse etablieren direkt die Szene: Der Sprecher steht vor einer schlafenden Frau und zögert, ob er sie küssen soll. Dieser Zögern wird durch die Forderung nach ihrer Reaktion, ob es als „zu zärtlich“ bestraft wird oder ob sie den Kuss erwiedert, ausgedrückt. Die Verwendung von direkten Befehlen wie „Erwache“ und „Schlaf“ verstärkt die Intimität und das spielerische Wesen des Gedichts.
Der zweite Teil des Gedichts vertieft sich in die Ambivalenz zwischen Unschuld und Verlangen. Die „Unschuld, die nur halb erwacht“ wird mit dem Zustand des Begehrens in Verbindung gebracht, der Träume hervorbringt, die als „Spröde sich zu wünschen pflegen“. Dies deutet auf die Komplexität der menschlichen Natur und die Gratwanderung zwischen Zurückhaltung und Erregung hin. Die Zeilen spielen gekonnt mit der Vorstellung von Träumen, in denen Wünsche Gestalt annehmen können, und weben so eine Atmosphäre der Fantasie und des verborgenen Begehrens.
In den abschließenden Versen wendet sich das Gedicht der Frage zu, wie man mit dieser subtilen Form des Verlangens umgeht. Wenn die Frau der Liebe keinen Raum geben kann oder will, sollte sie sich zumindest an der Illusion, der „Bild“ der Liebe, erfreuen. Dieser Schluß deutet auf eine pragmatische Akzeptanz der Grenzen der menschlichen Erfahrung hin. Es ist eine Einladung, die Schönheit der Fantasie und des Genusses anzuerkennen, selbst wenn die vollständige Erfüllung unerreichbar ist. Das Gedicht feiert letztendlich die Feinheiten des Verlangens, die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit und die Kunst, das Vergnügen auch in der Unschlüssigkeit zu finden.
Hagedorns Stil ist leicht und elegant, geprägt von einer spielerischen Verwendung von Sprache. Die Anordnung von Reimen und Metrum verleiht dem Gedicht einen beschwingten Rhythmus, der sowohl die Leichtigkeit der Situation als auch die ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema der Liebe und des Begehrens widerspiegelt. Durch die Verwendung von direkter Ansprache und rhetorischen Fragen schafft der Dichter eine enge Bindung zwischen dem Sprecher und der schlafenden Frau, wodurch der Leser direkt in die intime Atmosphäre des Gedichts eintaucht.
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.