Töne länger, Silberstimme! klage
Seelenwohllaut tiefer mir in′s Herz!
Ach! wie Augenblick′ entflöhen Tage
Mir in Thränen, mir bei Orpheus Schmerz.
Zauberin! von welchen Harmonieen
Hast Du Ton, und Red′ und Sang entlehnt?
Länger athmend mit Iphigenien
Fühlt′ ich Gluck aus Deiner Brust verschönt!
An eine Sängerin
Mehr zu diesem Gedicht
Gedicht als Bild, zum Downloaden und Teilen
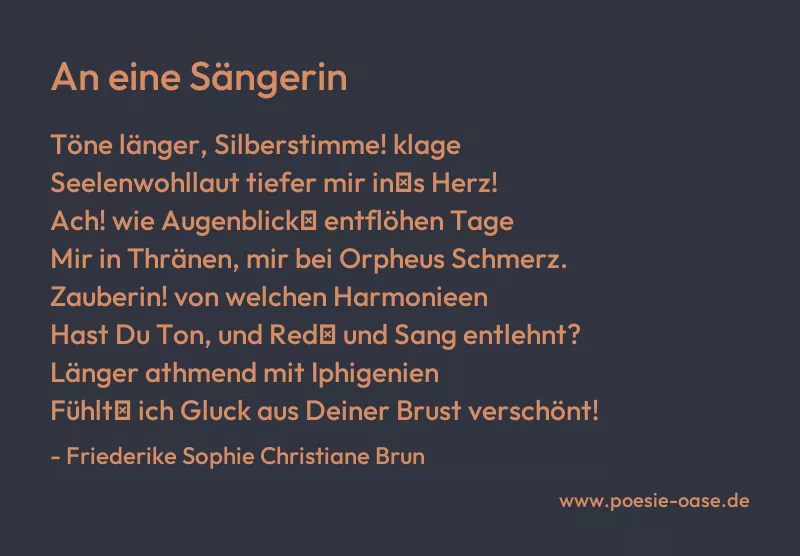
Kurze Interpretation des Gedichts
Das Gedicht „An eine Sängerin“ von Friederike Sophie Christiane Brun ist eine innige Hommage an die Kunstfertigkeit einer Sängerin und die emotionale Wirkung ihrer Darbietung. Es beginnt mit einer direkten Ansprache, einem Flehen nach längeren, tiefgreifenderen Tönen, die das Herz der Zuhörerin berühren. Der Fokus liegt auf der Intensität des Erlebens, der Sehnsucht nach tieferem Gefühl, die durch die Musik geweckt wird. Das lyrische Ich drückt die Vergänglichkeit der Zeit und die tiefe Trauer aus, die durch die Musik ausgelöst wird, indem es sich mit dem Leid des Orpheus identifiziert.
In der zweiten Strophe wird die Sängerin als „Zauberin“ bezeichnet, was ihre Fähigkeit, Emotionen hervorzurufen und die Zuhörerin in ihren Bann zu ziehen, unterstreicht. Die Frage nach den „Harmonieen“, aus denen sich ihr Gesang speist, deutet auf Bewunderung und Ehrfurcht vor der Kunstfertigkeit der Sängerin hin. Der Vergleich mit Iphigenie und Christoph Willibald Gluck, der durch die Musik der Sängerin zum Leben erweckt wird, etabliert eine Verbindung zur griechischen Mythologie und der Kunst des Opernkomponisten Gluck. Dies hebt die Qualität des Gesangs hervor und ordnet ihn in die Tradition der großen, emotionsträchtigen Kunst ein.
Die Verwendung von Begriffen wie „Silberstimme“ und „Seelenwohllaut“ deutet auf die ästhetische Wertschätzung der Klangfülle und der ergreifenden Melodie hin. Die Sehnsucht nach dem Gefühl, das durch die Musik ausgelöst wird, wird verstärkt, indem das lyrische Ich sich in die „Thränen“ der Musik hineinbegibt. Das lyrische Ich scheint ein tiefes Verständnis für die Macht der Musik zu haben, Gefühle wie Trauer und Leid, aber auch Schönheit und Harmonie zu erwecken.
Insgesamt ist das Gedicht eine Ode an die transformative Kraft der Musik und die Fähigkeit einer begabten Sängerin, tiefe Emotionen im Zuhörer zu entfachen. Es spiegelt die Romantik der Epoche wider, in der Gefühle, Schönheit und die Verbindung zur Kunst einen hohen Stellenwert hatten. Die Dichtung unterstreicht die Fähigkeit der Musik, die Seele zu berühren und uns mit den großen Themen des Lebens, wie Liebe, Verlust und Schönheit, zu konfrontieren.
Weitere Informationen
Hier finden sich noch weitere Informationen zu diesem Gedicht und der Seite.
Lizenz und Verwendung
Dieses Gedicht fällt unter die „public domain“ oder Gemeinfreiheit. Gemeinfreiheit bedeutet, dass ein Werk nicht (mehr) durch Urheberrechte geschützt ist und daher von allen ohne Erlaubnis des Urhebers frei genutzt, vervielfältigt und verbreitet werden darf. Sie tritt meist nach Ablauf der gesetzlichen Schutzfrist ein, z. B. 70 Jahre nach dem Tod des Autors. Weitere Informationen dazu finden sich hier.
